Kunden finden ohne Kaltakquise: Dein 90-Tage-Plan als Freelancer in der Schweiz
Einleitung
Stell dir vor, dein Kalender sieht aus wie ein leerer Kühlschrank – und der Monat ist noch lang.
Du scrollst durch LinkedIn, siehst andere voll ausgebucht und denkst dir: „Wie zum… machen die das bloss?“
Du bist nicht faul. Du bist nicht untalentiert. Du bist einfach gerade im „Wo-sollen-meine-Kunden-herkommen?“-Modus – und der frisst Energie.
Die gute Nachricht: Es liegt selten an der fehlenden Zeit, sondern meist am Fokus. Mehr dazu erfährst du hier: Als Freelancer fehlt dir keine Zeit, sondern Fokus
Die gute Nachricht: Du musst dafür nicht zum Kaltakquise-Roboter werden. In den nächsten 90 Tagen kannst du deinen Kalender füllen, ohne einen einzigen nervigen Pitch am Telefon.
Trotzdem: Ganz ohne Telefon wird Vertrieb nie funktionieren. Richtig eingesetzt kann es ein echter Gamechanger sein – lies hier mehr dazu: Die Kaltakquise ist tot, es lebe die Kaltakquise.
Lass uns anfangen – dein Fahrplan wartet schon.
Phase 1: Präsenz & Vorbereitung auf LinkedIn (Tag 1–15)
Dein erster Schritt: eine persönliche DM auf LinkedIn. Keine Massenbotschaften, keine Floskeln. Stattdessen ein ehrlicher Einstieg, zum Beispiel:
„Hallo [Name], dein letzter Post über [Thema] hat mich echt inspiriert, besonders der Teil über [Detail]. Danke dafür!“
Ziel: Ein Gespräch starten, nicht sofort verkaufen.
Danach optimierst du dein Profil:
• Headline: „Ich helfe [Zielgruppe], [konkretes Problem] zu lösen, messbar und effizient“.
• Info-Abschnitt: Kurz, klar, mit einem Call-to-Action.
• Bannerbild: Dein Nutzenversprechen in einem Satz, visuell auffällig.
→ Wie du auf LinkedIn wirklich Aufmerksamkeit bekommst, erfährst du hier: 7 Tricks, um auf LinkedIn als Architekt endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst.
Ab Tag 5 erstellst du deinen Content-Plan. Wähle drei Themen, die deine Expertise zeigen und Probleme deiner Zielgruppe treffen (z. B. Fallstudien, schnelle Tipps, Branchen-Trends). Mixe Formate: knackige Tipps, kurze Storys, Karussells.
Ab Tag 8 startest du deine erste Content-Welle. 3–4 Posts, die deine Kompetenz und Persönlichkeit zeigen. Werde auch in den Kommentaren anderer sichtbar – so baust du Reichweite auf, bevor du jemals pitchen musst.
>> Weiterführend: LinkedIn-Profil für Freelancer: Was Schweizer Auftraggeber wirklich überzeugt
Phase 2 – Netzwerkaufbau & Social Selling für Freelancer (Tag 16–45)
Jetzt wächst dein Netzwerk gezielt. Sende täglich 5–10 personalisierte Kontaktanfragen:
„Hallo [Name], ich sehe, wir arbeiten beide im Bereich [Branche], würde mich freuen, mich zu vernetzen.“
Sobald jemand annimmt, schreib zurück. Kein Verkauf, keine PDFs. Einfach echtes Interesse. Reagiere auf ihre Posts, teile nützliche Links, stelle Fragen. Vertrauen entsteht oft durch kleine, wiederholte Gesten.
Einmal pro Woche: Soft Offer. Zum Beispiel:
„Wenn du magst, kann ich dir zeigen, wie ich das Thema bei anderen gelöst habe.“
Das wirkt, ohne zu drängen – und öffnet Türen für spätere Gespräche.
>> Dein Freelancer-Profil: Wie du dein Profil zum Kundenmagnet verwandelst
Phase 3: Netzwerkaufbau & Social Selling für Freelancer (Tag 16–45)
Jetzt werden Kontakte zu Kunden. Teile gezielt Inhalte, die Beweise liefern:
• Fallstudien mit Vorher/Nachher-Effekt.
• Behind the Scenes-Einblicke in deinen Prozess.
• Aktuelle Branchen-Insights, die Probleme deiner Zielgruppe adressieren.
Ab Tag 55 bietest du kostenlose Micro-Formate an – zum Beispiel eine 15-minütige Mini-Analyse oder eine kleine Checkliste. Das zeigt, dass du helfen kannst, bevor du bezahlt wirst.
Zwischen Tag 60–75: Empfehlungen aktiv anstossen. Bitte zufriedene Kunden um LinkedIn-Referenzen. Teile ihre Erfolgsgeschichten in deinem Feed – Social Proof ist einer der stärksten Vertrauensfaktoren.
>> Das könnte dich auch interessieren: So nutzt du Fallstudien auf LinkedIn, um Kunden zu gewinnen
Phase 4 – Abschlussphase & Vollbuchung (Tag 76–90)
Jetzt schliesst du die letzten offenen Deals ab. Folge bei bestehenden Gesprächen nach, kläre offene Fragen, setze klare Fristen. Mach es leicht, Ja zu sagen.
An Tag 86–89 veröffentlichst du einen Post mit limitierter Verfügbarkeit:
„Noch 2 freie Plätze für September. Danach bin ich ausgebucht bis November.“
Diese kleine Dringlichkeit sorgt oft für schnelle Entscheidungen.
Am Tag 90 kommt dein „Ich bin voll“-Post: Dank ans Netzwerk, ein kurzes Learning aus den letzten 90 Tagen, vielleicht ein Fun Fact. Kein Angeben – einfach ein ehrliches Signal, dass dein Plan funktioniert hat.
>> Customer Testimonials: So schreibst Testimonials, die zeigen, was dein Projekt beim Kunden wirklich bewirkt hat
Wenn der Knoten endlich platzt
Vielleicht sitzt du gerade da und denkst: „Klingt ja alles gut… aber bei mir wird’s bestimmt wieder anders laufen.“
Dieser Gedanke ist okay. Wirklich. Jeder, der am Anfang steht, kennt dieses leise Ziehen im Bauch, wenn er an volle Auftragsbücher denkt – und gleichzeitig Angst hat, dass der Platz darin für ihn nicht reserviert ist.
Aber schau mal, was du jetzt hast: Einen Plan, der dich vom ersten vorsichtigen „Hi“ in einer LinkedIn-DM bis zu dem Moment bringt, in dem du sagen kannst: „Ich bin voll.“ Keine Ratespiele, keine Kaltakquise-Qual, keine endlosen Abende mit dem Gefühl, dass nichts vorangeht.
Du hast jetzt Werkzeuge, um sichtbar zu werden, echte Beziehungen aufzubauen und Kunden zu gewinnen, die dich wollen – nicht nur brauchen. Schritt für Schritt, Tag für Tag.
Und wenn du dir irgendwann unsicher bist, erinnere dich daran: Der Unterschied zwischen denen, die es schaffen, und denen, die aufgeben, ist nicht Talent oder Glück. Es ist der Mut, anzufangen… und dranzubleiben.
Also, los. Füll deinen Kalender. Zeig, dass es geht. Mach dich selbst zu dem Beweis, den andere gerade so dringend brauchen.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Kunden gewinnen mit Fallstudien auf LinkedIn. 7 überraschende Tipps, die sofort wirken
Einleitung
Warum bringen deine Fallstudien Likes, aber keine Kunden?
Oft, weil sie wie Werbung klingen statt wie echte Geschichten.
Das Problem: Auf LinkedIn will niemand von dir vollgetextet werden. Aber jeder will Geschichten lesen, in denen er sich wiedererkennt.
Hier sind 7 praxisnahe, teils überraschende Wege, wie du Fallstudien so einsetzt, dass sie nicht nur gelesen, sondern auch gebucht werden.
1. Fallstudien auf LinkedIn starten mit dem Problem – nicht mit dir
Viele beginnen ihre Fallstudie mit „Wir haben für Kunde X …“.
Das ist so spannend wie ein Beipackzettel.
Starte mit dem Schmerzpunkt deines Kunden:
„Kunde X bekam nur 3 Anfragen im Monat – und stand kurz vor der Aufgabe.“
So fühlt sich der Leser sofort abgeholt, weil er sein eigenes Problem wiedererkennt.
2. Bau Spannung auf wie in einer Mini-Serie
Strukturiere deine Fallstudie wie eine kleine Serie:
Ausgangssituation → Hindernisse → Durchbruch → Ergebnis.
Halte die Auflösung kurz zurück. Lass den Leser fragen: „Schaffen sie’s?“
So steigert sich die Neugier – und die Wahrscheinlichkeit, dass er bis zum Ende liest.
3. Nutze Zahlen, die überraschen – nicht nur beeindrucken
„+200 % Umsatz“ klingt nach Marketing-Broschüre.
Besser: „Von 3 Anfragen pro Monat auf 11 – in nur 6 Wochen.“
Kleinere, konkrete Zahlen wirken glaubwürdiger und zeigen echten Fortschritt.
4. Zeig, was schiefging – und gewinne Vertrauen
Perfekte Geschichten wirken oft unecht.
Erwähne einen Umweg oder eine Hürde, die ihr überwinden musstet.
Beispiel: „Nach Woche 2 sanken die Zahlen kurz, weil wir zu viel gleichzeitig testeten – dann haben wir Fokus reingebracht.“
Das macht dich nahbar und unterstreicht deine Problemlösungskompetenz.
5. Lass den Kunden selbst sprechen
Ein echter Satz des Kunden ist Gold wert.
Das kann aus einer E-Mail, einem Feedback oder sogar einer Sprachnachricht stammen.
Extra-Tipp: Screenshots solcher Aussagen funktionieren auf LinkedIn besonders gut – sie wirken authentischer als jede Eigenwerbung.
6. Versteck den Call-to-Action mitten im Text
Am Ende plump „Schreib mir“? Funktioniert selten.
Besser: Im Verlauf sanft einstreuen, z. B.:
„Falls dich das gerade an deine Situation erinnert – wir sollten reden.“
So fühlt sich der CTA wie Teil der Story an, nicht wie ein Verkaufsgespräch.
7. Baue einen visuellen Aufhänger, der hängenbleibt
LinkedIn ist visuell.
Nutze Vorher/Nachher-Grafiken, Whiteboard-Fotos oder handgezeichnete Skizzen.
Beispiel: Ein Foto vom echten Notizblock, auf dem der Plan entstand – roh, persönlich und ohne Stockfoto-Charme.
Fazit & Umsetzungsschritt
Fallstudien sind kein Portfolio-Eintrag. Sie sind ein Beweisstück für deine Kompetenz – und ein Türöffner zu neuen Kunden.
Starte am besten sofort:
• Such dir eine Kundengeschichte, die ein konkretes Problem löst.
• Forme daraus eine kurze Story mit diesen 7 Punkten.
• Poste sie auf LinkedIn – und beobachte, wer sich meldet.
Fallstudien, die Kunden gewinnen, sind nicht die lautesten – sondern die, in denen sich der Leser selbst wiederfindet.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Freelancer oder Angestellter: Vor- und Nachteile im direkten Vergleich
Vielleicht erwischst du dich schon länger bei dieser Frage. Mal bist du sicher, die Antwort zu kennen. Dann wieder liegst du nachts wach und denkst: „Was, wenn ich die falsche Richtung einschlage?“ Kein Wunder, es geht um deine Zukunft, deine Freiheit, deinen Kontostand. Und ja, dieser Knoten im Bauch ist normal. Viele Profis, die nach außen souverän wirken, haben genau denselben. In den nächsten Minuten bekommst du klare Denkanstöße, die dir helfen, den Nebel zu lichten und eine Entscheidung zu treffen, die sich wirklich nach dir anfühlt.
Gehaltsentwicklung: Wer bestimmt, wie viel du verdienst?
In einer Festanstellung legt jemand anderes fest, wie hoch du steigen kannst. Gehaltserhöhungen sind oft zäh, abhängig von Budgets, Bewertungen und interner Politik. Als Freelancer bestimmst du den Preis selbst. Klingt verlockend, oder? Der Haken: Dein Marktwert hängt davon ab, wie gut du dich positionierst.
Beispiel: Ein Designer verdoppelt seinen Stundensatz, verliert nur einen Kunden, gewinnt aber drei neue – mit mehr Respekt und weniger Stress.
Reflexionsfrage: Könntest du deinen aktuellen Stundensatz innerhalb von 6 Monaten realistisch anheben?
Freizeitplanung: Fester Urlaub oder volle Flexibilität?
Fester Urlaub klingt sicher. Die Planung ist berechenbar. Als Freelancer kannst du dir auch spontan einen Dienstag freinehmen. Aber Freiheit fühlt sich nur gut an, wenn du sie dir leisten kannst. Wer keinen Puffer hat, sitzt im Schatten der Strandbar, während die Sonne ins Wasser glitzert – und tippt Mails, während die Familie im Meer lacht.
Reflexionsfrage: Könntest du vier Wochen am Stück offline gehen, ohne dass dein Einkommen leidet?
Job-Sicherheit: Mehr Risiko im Unternehmen oder in der Selbstständigkeit?
Viele Angestellte denken: „Mein Job ist sicher.“ Doch Sicherheit kann trügerisch sein. Eine Bilanz in Schieflage, und die Kündigung liegt auf dem Tisch. Freelancer haben keinen Kündigungsschutz, dafür mehrere Kunden. Fällt einer weg, bleiben andere.
Kontraintuitiv: Manchmal ist die Abhängigkeit von einem Arbeitgeber riskanter als mehrere kleine Aufträge.
Reflexionsfrage: Hängt dein Einkommen heute von einer einzigen Quelle ab?
Weiterentwicklung: Wer steuert deine Karriere?
In Firmen gibt es oft feste Karrierepfade. Du gehst, wohin das Unternehmen geht. Als Freelancer steuerst du selbst, ob du neue Fähigkeiten lernst, Branchen wechselst oder komplett neu startest.
Beispiel: Ein Texter, der sich auf KI-gestützten Content spezialisiert, wächst in Monaten dorthin, wofür Angestellte Jahre brauchen.
Reflexionsfrage: Lernst du gerade Fähigkeiten, die dich in fünf Jahren relevant halten?
Planbarkeit oder Wachstumsschub: Was bringt dich weiter?
Ein fester Job gibt Struktur. Du weißt, was am Monatsende auf dem Konto ist. Freelancer-Leben bedeutet Schwankungen. Mal prall gefüllt, mal Ebbe. Doch im Chaos steckt Potenzial. Eine Anfrage kann den Umsatz verdoppeln.
Der Trick: Unruhe nicht als Bedrohung sehen, sondern als Chance auf Sprungwachstum.
Reflexionsfrage: Könntest du mit unvorhersehbaren Einnahmen umgehen, wenn das Potenzial deutlich höher wäre?
Marke: Dein Name oder das Firmenlogo?
In einer Anstellung bist du Teil einer Marke. Als Freelancer bist du die Marke. Das kann stolz machen oder Druck erzeugen. Es ist ein Unterschied, ob der Kunde sagt: „Das war ein tolles Projekt von Firma XY“ oder „Das war großartig, weil du es gemacht hast.“
Reflexionsfrage: Möchtest du, dass deine Arbeit untrennbar mit deinem Namen verbunden ist?
Erfüllung: Was macht dich wirklich stolz?
Manche blühen in großen Teams auf. Andere wollen direkte Erfolge sehen. Es geht nicht darum, was objektiv besser ist, sondern was dich langfristig zufrieden macht.
Reflexionsfrage: Wann hattest du zuletzt das Gefühl, dass deine Arbeit dich wirklich erfüllt?
>> Freelancer in der Schweiz aufgepasst: Was du 2025 beachten musst
Am Ende zählt nur, was zu dir passt
Vielleicht schwirrt dir jetzt der Kopf. Du hast die Vor- und Nachteile gesehen, dir ein paar „Was wäre, wenn…?“ Szenarien durchgespielt. Und vielleicht denkst du gerade: „Was, wenn ich trotzdem die falsche Wahl treffe?“ Dieser Gedanke ist normal. Jeder, der etwas verändern will, kennt diesen kleinen Knoten im Bauch.
Aber genau hier liegt dein Vorteil: Du weißt jetzt, worauf es wirklich ankommt. Nicht auf Titel oder Verträge. Sondern auf Freiheit, Sicherheit, Wachstum – und wie du diese für dich definierst. Du hast gelernt, dass vermeintliche Sicherheiten bröckeln können und dass Chaos nicht nur Risiko, sondern auch Raketenstart sein kann.
Also hör hin, wenn dein Kopf rechnet und dein Herz flüstert. Trau dich, deinen Weg zu gehen, auch wenn er nicht gerade ist. Denn der Mut, dich zu entscheiden, ist immer der erste Schritt zu der Karriere, die sich richtig anfühlt. Und das ist unbezahlbar.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Warum Projektübergaben fast immer mehr kosten – und was intern vs. extern den Unterschied macht
Stell dir vor:
Das Projekt läuft, alle Deadlines sind gesetzt – und plötzlich steht eine Übergabe an.
Egal ob der Kollege in ein anderes Projekt wechselt oder ein externer Freelancer übernimmt:
Die Kosten schiessen fast immer über das Budget hinaus.
Der Grund: Meist wird nur der geplante Stundenblock gesehen – und all die kleinen, versteckten Nebeneffekte bleiben unberücksichtigt.
Das Ergebnis? Doppelte Ressourcen, Wissenslücken, Verzögerungen – und am Ende eine unangenehme Überraschung in der Kostenübersicht.
Hier erfährst du, wo wo das Geld wirklich hinfliesst und wie du Übergaben in Zukunft realistisch kalkulierst.
Die 6 Hauptgründe, warum Übergaben teurer sind als gedacht
1. Zusätzliche Kommunikationsrunden
- Mehr Meetings, Absprachen und Rückfragen, bis der neue Verantwortliche im Thema ist
- Fehlt eine aktuelle Dokumentation, wird jede Info zur EinzelfrageWird die App intern angenommen?
2. Wissenslücken & Kontextverlust
- Implizites Wissen steckt im Kopf des Vorgängers – und steht nicht in Dokumenten
- Kleine Prozessdetails oder Tool-Logiken fallen oft erst später auf → teure Nacharbeit
3. Parallelarbeit
- Alt & Neu arbeiten eine Zeit lang gleichzeitig → doppelte Personalkosten
- Bei Freelancern: zusätzlich der externe Stundensatz
4. Qualitätseinbußen & Nacharbeit
- Fehlende Übergabedetails führen später zu Fehlern
- Nachträgliche Korrekturen kosten fast immer mehr, als sie gleich in der Übergabe zu klären
5. Verzögerungskosten
- Übergaben verschieben Meilensteine
- Im B2B können Pönalen oder entgangener Umsatz drohen
6. Administrativer Zusatzaufwand
- Intern: Umpriorisierung im Team
- Extern: NDA, Verträge, On-/Offboarding, Zugangsrechte
>> Freelancer in der Schweiz aufgepasst: Was du 2025 beachten musst
2. Interne vs. externe Übergaben – der direkte Vergleich
Der Unterschied zwischen interner und externer Übergabe ist nicht nur eine Frage der Stunden, sondern auch von Wissenstransfer, Organisation und Zusatzkosten.
| Faktor | Interne Übergabe | Externe Übergabe (Freelancer) |
|---|---|---|
| Einarbeitungszeit | Kürzer – gleiche Tools & Kultur | Länger – Prozesse müssen erklärt werden |
| Zusätzliche Kostenblöcke | Meist nur Personalkosten | Honorare + oft höhere Stundenansätze |
| Implizites Wissen | Bleibt eher in der Organisation | Gefahr: Wissen geht nach Projektende verloren |
| Admin-Aufwand | Geringer | Höher (NDA, Verträge, On-/Offboarding) |
| Risiko von Verzögerungen | Mittel | Höher, Verfügbarkeit evtl. eingeschränkt |
| Kosten bei Parallelphasen | Doppelte interne Stunden | Doppelte Stunden + externer Satz → teurer |
3. Typische Kostenfallen bei Übergaben – Checkliste
✅ Vorher erfassen:
- Briefing-Meetings
- Dokumentations-Update
- Wissensweitergabe
- Tool- und Prozessschulungen
✅ Zusatzposten beachten:
- Intern: Opportunitätskosten (was könnte der Mitarbeiter in dieser Zeit sonst leisten?)
- Extern: Stundensatz/Tagessatz für reine Einarbeitungszeit
✅ Risikopuffer einplanen:
- +10–30 % Zeitbudget
- +5–15 % Nachbearbeitungskosten
4. Mini-Rechenbeispiel – intern vs. extern
Denn:
Interne Übergabe (Consulting-Projekt)
- Geplant: 16 h × 80 CHF/h = CHF 1’280
- Tatsächlich: 31 h = CHF 2’480 (+90 %)
Mit Freelancer
- 31 h × 120 CHF/h = CHF 3’720
- Admin-Aufwand: 2 h HR & IT × 80 CHF/h = CHF 160
- Gesamt: CHF 3’880 → über 200 % teurer als geplant
5. Empfehlungen zur Kostendämpfung
- Frühzeitig planen, nicht in den letzten zwei Tagen
- Dokumentation parallel zum Projekt führen
- Wissensverantwortliche benennen, die auch nach der Übergabe verfügbar bleiben
- Übergabe-Checkliste nutzen, damit nichts vergessen wird
Für externe Übergaben:
- Projektunabhängige Infos vorab schriftlich geben → reduziert teure Einarbeitungsstunden
- Verfügbarkeit früh klären, um Verzögerungen zu vermeiden
Fazit – So vermeidest du teure Überraschungen
Projektübergaben sind fast immer Kostentreiber – durch doppelte Ressourcen, Wissenslücken und Verzögerungen.
Der grösste Unterschied zwischen interner und externer Übergabe: zusätzliche Honorare und höherer Admin-Aufwand bei Freelancern.
Wer diese Faktoren von Anfang an realistisch einkalkuliert, spart sich am Ende nicht nur Geld, sondern auch Nerven.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Wenn Kundenpläne kippen: So reagieren Schweizer Freelancer souverän auf kurzfristige Änderungen
Plötzlich will der Kunde etwas anderes. Neuer Umfang, neue Deadline, neue Extras, und du sitzt da und fragst dich:
„Wie soll ich das jetzt noch hinkriegen?“
Kurzfristige Änderungen sind nervig, manchmal sogar richtig frustrierend. Klar, man will professionell wirken, aber insgeheim nervt’s, wenn die ganze Planung über den Haufen geworfen wird.
Genau hier zeigt sich, ob man nur reagiert oder clever vorbereitet ist.
1. Verträge, die Spielraum lassen
Ein Projekt beginnt oft voller Energie – und endet dann ganz anders, als es auf dem Papier stand.
Deshalb sind klare Verträge Gold wert. Sie regeln, was passiert, wenn der Kunde plötzlich neue Features will oder die Deadline verschiebt.
Ein Beispiel: Ein Designer vereinbart von Anfang an, dass jede Änderung nach der dritten Korrekturrunde extra berechnet wird. Klingt streng, schützt aber vor endlosen Anpassungen.
Überraschend: Je klarer die Regeln sind, desto entspannter wird die Zusammenarbeit. Kunden wissen, woran sie sind – und genau das schafft Vertrauen.
>> Fehler im Vertrag: Diese 5 rechtlichen Fehler ruinieren dein Business – wenn du sie nicht vermeidest
2. Digitale Tools für schnelle Anpassung
Slack für Absprachen, Trello fürs Projektmanagement, PayFlow für die Abrechnung.
Diese Tools machen Änderungen überschaubar.
Stell dir vor: Ein Kunde will spontan einen zusätzlichen Report. Statt E-Mails hin und her zu schicken, wird er einfach als neue Karte ins Board gezogen.
Plötzlich ist die Sache halb so wild.
Und kontraintuitiv: Nicht mehr Tools machen dich flexibel, sondern die konsequente Nutzung weniger Tools.
Doch Technik allein reicht nicht. Ohne aktuelles Wissen bleibt man trotzdem stecken.
>> Hier findest weitere Tools für Freelancer: Diese 7 Buchhaltungs-Tools sparen dir Zeit, Nerven und Geld
3. Weiterbildung als Geheimwaffe
Neue Anforderungen sind oft auch neue Chancen.
Wer regelmässig in Kurse, Zertifikate oder Branchenevents investiert, bleibt beweglich.
Ein Entwickler, der früh mit KI-Tools arbeitet, punktet sofort, wenn der Kunde nach einer Automatisierung fragt.
Andere suchen noch nach Tutorials, er liefert schon.
Weiterbildung kostet Zeit – aber sie spart in Stresssituationen doppelt so viel.
Aber selbst das beste Wissen stößt an Grenzen, wenn die Arbeit zu groß wird.
>> Entdecke Weiterbildungskurse für Freelancer: 10 zertifizierte Skills, die dir helfen, mehr Jobs zu gewinnen – auch ohne teure Kurse
4. Gemeinsam stark – Netzwerke nutzen
Manchmal reicht die eigene Power nicht.
Dann hilft ein starkes Netzwerk. Freelancer schließen sich zu kleinen Teams oder Micro-Agencies zusammen.
Ein Texter ruft eine Designerin an, wenn der Kunde plötzlich doch eine Infografik will.
Aus Stress wird Synergie.
Überraschend für viele: Kunden sehen diese Flexibilität nicht als Schwäche, sondern als Zeichen von Professionalität.
Neben Wissen und Kontakten zählt aber noch etwas anderes: Freiheit.
5. Freiheit von Ort und Zeit
Flexibilität heißt auch: nicht am Schreibtisch kleben.
Ob im Zug, im Café oder am Küchentisch – dein Arbeitsplatz passt sich dir an, nicht umgekehrt.
Und die Uhr? Die tickt nicht immer von neun bis fünf.
Wer seine Hochphasen kennt, arbeitet dann – auch wenn es mal spätabends ist.
Kontraintuitiv, aber wahr: Weniger starre Strukturen führen zu mehr Stabilität.
Doch Freiheit allein reicht nicht. Entscheidend ist, wie Ergebnisse sichtbar werden.
6. Ergebnisorientierung & klare Kommunikation
Am Ende zählt nicht, wie viele Stunden im Timesheet stehen.
Entscheidend ist, dass das Ergebnis passt. Freelancer, die diese Haltung leben, reagieren gelassener auf Änderungen.
Praxisbeispiel: Ein UX-Designer vereinbart fixe Abnahmetermine für Ergebnisse statt für Stunden.
So wird sofort klar, wann welches Ziel erreicht ist.
Wichtig bleibt die Kommunikation. Wer rechtzeitig sagt, was Änderungen für Zeit und Budget bedeuten, spart später endlose Diskussionen.
Genau das schafft Vertrauen – auch wenn es nicht immer die angenehmste Botschaft ist.
>> Weiterlesen: Ghosting im Freelancing: Wie du professionell mit Geisterkunden umgehst
7. Wenn alles Kopf steht – dein Vorteil im Chaos
Du kennst den Moment: Alles kippt, der Kunde will plötzlich mehr, schneller, anders.
Erst Chaos im Kopf – dann Druck im Bauch.
Doch genau da greifen deine Strategien:
- Verträge, die dich schützen.
- Tools, die dich entlasten.
- Wissen, das dich schneller macht.
- Menschen, die dich auffangen.
- Freiheit, die dich trägt.
- Und Klarheit, die Vertrauen schafft.
Das ist keine Last.
Das ist dein Vorteil.
Und wenn der Sturm tobt, bist du der Fels, der stehen bleibt.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Die 9 häufigsten Steuerfehler in der Schweiz – und wie dein Unternehmen sie vermeidet
Wusstest du, dass Schweizer Unternehmen jedes Jahr Millionen verschenken – nur weil sie ihre Steuererklärung falsch ausfüllen?
Viele dieser Fehler entstehen nicht durch Absicht, sondern durch Bequemlichkeit, Unwissen oder fehlende Planung. Das Ergebnis: zu hohe Steuern, unnötige Bussen und schmerzhafte Überraschungen.
Die gute Nachricht: Mit ein paar klaren Massnahmen lassen sich die meisten Stolperfallen umgehen. Hier sind die grössten Fehler – und wie du sie vermeidest.
1. Falsche Firmenform: Wenn die Rechtsform zur Steuerfalle wird
Viele starten mit einer Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft. Einfach und günstig, aber sobald der Umsatz steigt, kann diese Wahl teuer werden.
→ So vermeidest du es:
Prüfe regelmässig, ob eine GmbH oder AG sinnvoller ist. Beide bieten mehr Flexibilität und eine bessere Gewinnverwendung.
2. Geschäftsführerlöhne falsch angesetzt
Zu hoher Lohn = unnötige Steuern und Abgaben.
Zu tiefer Lohn = Risiko verdeckter Gewinnausschüttung.
→ So vermeidest du es:
Lohn an die wirtschaftliche Lage anpassen, transparent auszahlen, keine „Entnahmen ohne Deklaration“.
3. Firmenfahrzeuge: Beliebt, aber oft falsch gehandhabt
Häufige Fehler: Privatanteil nicht korrekt, MWST falsch abgezogen.
→ So vermeidest du es:
Privatanteil korrekt deklarieren und prüfen, ob Firmen- oder Privatlösung besser ist.
4. Investitionen im falschen Moment
Unkoordiniert oder im Privatvermögen investiert – das kann steuerlich nachteilig sein.
→ So vermeidest du es:
Investitionen strategisch planen, ggf. Holding-Struktur prüfen, Timing und Status abstimmen.
5. Personaladministration: Kleine Fehler, grosse Folgen
Falsche Abzüge, fehlende Meldungen, verspätete Eintritte → Nachzahlungen und Bussen.
→ So vermeidest du es:
Prozesse standardisieren, digitale Tools nutzen, Lohnabrechnungen regelmässig prüfen.
6. Abzüge vergessen = Geld verbrennen
Viele KMU lassen zulässige Abzüge (Weiterbildung, Berufsauslagen, Wertschriften) liegen.
→ So vermeidest du es:
Abzugsliste führen, Angaben doppelt prüfen, bei Unsicherheit Treuhänder beiziehen.
7. Firmenumwandlung ohne Plan
Unsaubere Umwandlungen (z. B. Einzelfirma → GmbH) können zur Besteuerung stiller Reserven führen.
→ So vermeidest du es:
Umwandlungen steuerneutral gestalten und vorab mit Fachperson abklären.
8. Fehlende Steuerplanung und verpasste Fristen
Keine Strategie, keine Fristerstreckung, keine Optimierung – das wird teuer.
→ So vermeidest du es:
Frühzeitig planen, Reminder setzen, Optionen mit Experten prüfen.
9. Buchhaltung in Excel: teuer, fehleranfällig, nicht revisionssicher
Excel wirkt am Anfang praktisch – skaliert aber schlecht. Typische Risiken: manuelle Fehler, fehlender Audit-Trail, doppelte Erfassung, inkonsistente Versionen, mühsame MWST-Abstimmung, fehlende Schnittstellen (E‑Banking, Lohn, Debi/Kredi), aufwändige Auswertungen bei Prüfungen.
→ So vermeidest du es:
- Auf Buchhaltungssoftware mit Beleg-Scan, automatischer Verbuchung, MWST-Logik und Audit-Trail umsteigen.
- Standard-Kontenplan nutzen und Regeln/Workflows definieren (z. B. wiederkehrende Belege).
- Schnittstellen aktivieren (E‑Banking, Lohn, Debitoren/Kreditoren, QR‑Rechnung).
- Zugriffsrechte für Treuhand/Revision rollenbasiert vergeben.
Fazit: Vier Schritte, die dich sofort absichern
Die meisten Steuerfehler entstehen nicht aus böser Absicht, sondern aus fehlender Planung. Mit wenigen, klaren Schritten sparst du Geld – und Nerven.
✅ Mini-Checkliste:
- Firmenform regelmässig prüfen
- Alle Abzüge sauber erfassen
- Fristen im Blick behalten
- Buchhaltung digitalisieren (Software statt Excel)
➡️ Mein Tipp: Beginne bei den Grundlagen: Firmenform, Abzüge, Fristen und Buchhaltung. Wer diese Basis im Griff hat, schafft die Grundlage für Wachstum und nachhaltigen Erfolg.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
So vermeiden Freelancer in der Schweiz die häufigsten Finanzfallen
Hand aufs Herz: Machen dir deine Finanzen manchmal Bauchschmerzen? Rechnungen trudeln unregelmässig ein, Kunden zahlen spät, und währenddessen sitzt dir das Steueramt im Nacken. Kein Wunder, dass man nachts wachliegt und denkt: „Hoffentlich reicht’s am Ende des Monats…“
Genau damit schlagen sich unzählige Freelancer auch herum, auch wenn man nach aussen immer so tut, als wär alles easy.
Darum geht’s hier: die häufigsten Finanzfallen entlarven und dir zeigen, wie du sie clever umgehst. Damit du wieder mehr Ruhe im Kopf und Kontrolle im Portemonnaie hast.
1. Geschäfts- und Privatfinanzen trennen: dein erster Schutzschild
Viele Freelancer starten mit nur einem Konto. Klingt unkompliziert, endet aber im Chaos. Private Spesen vermischen sich mit Geschäftsausgaben, und spätestens beim Steueramt wird’s heikel.
So vermeidest du es: Richte ein separates Geschäftskonto ein. So siehst du sofort, was reinkommt und rausgeht. Keine Sucherei, keine Überraschungen.
2. Rücklagen bilden: für Steuern und schwache Monate
Steuern, AHV, Versicherungen: Sie kommen sicher, nur nicht immer dann, wenn du Geld auf der Seite hast. Viele erwischt es eiskalt: Konto leer, Rechnung da.
So vermeidest du es: Überweise regelmässig einen Prozentsatz deiner Einnahmen auf ein Sparkonto. Drei bis sechs Monatsausgaben als Reserve sind realistisch. Kontraintuitiv: Es fühlt sich an, als ob du dir Geld „wegnimmst“. In Wahrheit kaufst du dir damit Freiheit.
3. Vorsorge & Versicherung: heute vorsorgen, morgen Freiheit sichern
„Ich bin gesund, das passt schon.“ Viele denken so, bis ein Unfall oder eine Krankheit das Einkommen stoppt. Ein gebrochenes Bein reicht, und schon fehlen Monate an Einnahmen.
So vermeidest du es: Sichere dich ab mit 3. Säule, freiwilliger Pensionskasse, Unfall- und Erwerbsausfallversicherung. Heute vorsorgen bedeutet morgen weniger Sorgen.
4. Zahlungsausfälle: wenn Kunden nicht zahlen
Du hast geliefert, aber das Geld kommt nicht. Frustrierend und brandgefährlich für deine Liquidität.
So vermeidest du es: Setze klare Zahlungsziele, arbeite mit Teilrechnungen oder Anzahlungen und prüfe neue Kunden. Lieber einmal „Nein“ sagen, als wochenlang deinem Geld hinterherrennen.
5. Buchhaltung und Administration: aufschieben macht’s nur schlimmer
Viele hassen den Papierkram. Aber „später“ wird schnell zu „zu spät“. Fehlende Belege, vergessene Ausgaben, verpasste Fristen, das kostet.
So vermeidest du es: Plane fixe Zeiten für die Buchhaltung. Nutze digitale Tools. Dokumentiere sofort statt Wochen später. Wer konsequent ist, spart Nerven und Geld.
6. Umsätze realistisch kalkulieren: statt schönrechnen
„Das nächste Projekt kommt bestimmt.“ Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Viele rechnen sich reich, bevor der Auftrag unterschrieben ist.
So vermeidest du es: Kalkuliere realistisch. Berücksichtige Fixkosten, Rücklagen, Versicherungen. Ein marktgerechter Stundensatz ist mehr als dein Wunschlohn, er ist dein Überlebensanker. Überraschend, aber wahr: Höhere Preise sichern oft nicht nur deine Finanzen, sondern schaffen auch mehr Respekt beim Kunden.
7. Cashflow planen: nicht nur auf den Umsatz schauen
Es ist nicht der Umsatz, der dich kippen lässt, sondern das Timing. Geld kommt spät, Rechnungen sind sofort fällig. Engpass vorprogrammiert.
So vermeidest du es: Plane deinen Cashflow. Überwache Ein- und Ausgänge. Nutze Tools, um Engpässe früh zu erkennen. Ein klarer Blick verhindert schlaflose Nächte.
8. Scheinselbstständigkeit: die unterschätzte Gefahr
Ein einziger Auftraggeber wirkt bequem. Doch rechtlich ist das riskant. Wer als Angestellter durchgeht, muss Beiträge nachzahlen. Teuer und schmerzhaft.
So vermeidest du es: Halte mehrere Kunden, gestalte Verträge sauber. Ein Kunde ist ein Auftrag, mehrere Kunden sind ein Geschäft.
9. Excel in der Buchhaltung: riskant und teuer
Am Anfang wirkt Excel praktisch. Doch bei Wachstum zeigen sich die Schwächen. Tippfehler, fehlender Audit Trail, doppelte Erfassung, Versionschaos, mühsame MWST-Abstimmungen und kaum Schnittstellen zu E Banking, Lohn oder Debitoren und Kreditoren. Bei einer Prüfung wird es schnell zäh und teuer.
So vermeidest du es: Steig auf Buchhaltungssoftware mit Belegscan, automatischer Verbuchung, MWST Logik und sauberem Journal um. Nutze Rollenrechte für Treuhand und Revision. Beispiel: Du fotografierst eine Quittung im Zug, und sie landet direkt im Journal.
Mehr Sicherheit, weniger Sorgen: dein nächster Schritt
Manchmal fühlt es sich an, als würde dir das Geld durch die Finger rinnen. Eine Rechnung flattert rein, der Kunde zahlt nicht, und im Hinterkopf hörst du diese Stimme: „Was, wenn’s am Ende nicht reicht?“
Genau hier setzt alles an, was du gerade gelesen hast:
- Klare Trennung von Finanzen gibt dir Ordnung.
- Rücklagen schenken dir Ruhe.
- Vorsorge macht dich unabhängig.
- Struktur in Buchhaltung und Cashflow bringt Stabilität.
Das bedeutet: mehr Freiheit, mehr Gelassenheit, mehr Fokus auf die Arbeit, die du liebst. Jede Entscheidung für Klarheit und Struktur ist ein kleiner Sieg. Diese Siege summieren sich, bis du spürst: „Ich hab das im Griff.“
Nicht irgendwann. Sondern jetzt.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Scheinselbstständigkeit in der Schweiz: was Freelancer wissen müssen
Scheinselbstständig? Klingt harmlos, ist aber für Freelancer in der Schweiz ein teurer Stolperstein. Viele wähnen sich auf der sicheren Seite, bis plötzlich die AHV klingelt und alles neu einordnet. Und das kann richtig wehtun – finanziell wie rechtlich.
Hier erfährst du, wie du erkennst, ob du gefährdet bist, welche Risiken wirklich zählen und welche Schritte dich vor bösen Überraschungen schützen.
1. Kein Gesetzestext, aber harte Realität
Viele denken, Scheinselbstständigkeit sei irgendwo im Gesetz klar geregelt. Tatsächlich gibt es keinen Paragrafen, der sie definiert.
Die Entscheidung liegt bei den AHV-Ausgleichskassen. Sie prüfen jeden Einzelfall. Manchmal reicht schon eine einzige unglückliche Konstellation, um dich vom Freelancer zum Angestellten zurückzustufen.
Viele verlassen sich auf eine AHV-Bescheinigung. Doch Vorsicht: Sie ist hilfreich, aber kein absoluter Schutz.
2. Typische Anzeichen für Scheinselbstständigkeit
Wie merkst du, ob du in die Falle läufst? Einige klare Signale:
- Weisungsgebundenheit bei Arbeitszeit, Ort oder Aufgaben
- Arbeiten überwiegend oder ausschliesslich für einen einzigen Kunden
- Nutzung der Infrastruktur des Auftraggebers
- Keine eigenen Investitionen oder Risiken
3. Die Checkliste der AHV – worauf es wirklich ankommt
Die AHV bewertet Selbstständigkeit nach mehreren Kriterien. Entscheidend sind:
- Mehr als 50 Prozent deines Einkommens stammen von einem Kunden
- Du bist weisungsgebunden
- Eigenständiger Marktauftritt (Website, Werbung, Rechnungen im eigenen Namen)
- Mehrere unterschiedliche Auftraggeber
- Eigene Investitionen und echtes unternehmerisches Risiko
4. Die Kosten der Scheinselbstständigkeit in der Schweiz
Wird die Tätigkeit rückwirkend als unselbstständig eingestuft, sind die Folgen happig:
- Nachzahlung von Sozialabgaben für bis zu fünf Jahre (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil)
- Kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung oder bezahlte Ferien
- Anpassung der Kranken- und Pensionskasse rückwirkend
- Für Unternehmen: Gefahr von Bussen, viel Administrationsaufwand und Imageschaden
5. So schützt du dich in der Praxis
Die gute Nachricht: Du kannst einiges tun, um dich abzusichern.
- Betreue mehrere Kunden gleichzeitig
- Nutze eigene Arbeitsmittel und trete klar am Markt auf
- Achte auf saubere Verträge mit klarer Eigenverantwortung
- Vermeide eine dauerhafte Integration in die Strukturen eines Kunden
- Beantrage eine AHV-Bescheinigung – kein absoluter, aber ein zusätzlicher Schutz
6. Sonderfall: ausländische Freelancer in der Schweiz
Für Freelancer aus dem Ausland gelten zusätzliche Spielregeln. Aufenthaltsfristen, Meldepflichten und Arbeitsbewilligungen sind oft strenger. Besonders heikel: Einsätze über 90 Tage.
Das bedeutet: Selbst wenn deine Aufträge sauber geregelt sind, kann der Aufenthaltstitel zur echten Stolperfalle werden.
7. Überraschende Wahrheiten, die kaum jemand sagt
- Auch Top-Verdiener können scheinselbstständig sein, wenn sie nur einen Kunden haben
- Freelancer-Plattformen schützen dich nicht automatisch
- In manchen Fällen haben Auftraggeber mehr zu verlieren als Freelancer selbst
Das klingt unlogisch, ist aber Realität.
8. Rechtliche Schritte bei Unsicherheit
Was tun, wenn du unsicher bist, ob deine Tätigkeit als selbstständig anerkannt wird?
- Beratung suchen: AHV-Ausgleichskasse oder ein spezialisierter Anwalt für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
- Dokumentation vorbereiten: Eigenes Marketing, mehrere Kunden, Investitionen – alles schriftlich belegen
- Verträge prüfen lassen: Lass wichtige Vereinbarungen juristisch abklären
- Frühzeitig handeln: Je eher du Klarheit hast, desto geringer das Risiko von Nachzahlungen
Klarheit statt Risiko: dein Weg als Freelancer
Scheinselbstständigkeit ist kein harmloser Graubereich, sondern ein ernstes Risiko.
Je klarer du deine Selbstständigkeit lebst, dokumentierst und nach aussen zeigst, desto sicherer bist du. Mehrere Kunden, eigene Arbeitsmittel und saubere Verträge sind deine stärksten Argumente.
Das gibt dir die Stabilität, die du brauchst, um dich auf das zu konzentrieren, was zählt: deine Arbeit und dein Wachstum.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Ausländischer Freelancer in der Schweiz: So vermeidest du die grössten Stolperfallen
In der Schweiz freelancen? Klingt nach Freiheit, spannenden Projekten und attraktivem Einkommen. Doch ohne Vorbereitung kann es schnell teuer oder sogar unmöglich werden.
Viele ausländische Freelancer unterschätzen, wie streng die Regeln hier sind. Vielleicht denkst du gerade: „Ich hab Aufträge, reicht das nicht?“ – leider nein. Aufenthaltsbewilligungen, Sozialabgaben, Krankenversicherung, Steuern… die Schweiz nimmt es genau.
Die gute Nachricht: Wer die Spielregeln kennt, hat alle Chancen auf einen erfolgreichen Start. In diesem Artikel erfährst du, was wirklich zählt – und welche Stolperfallen dich überraschen könnten.
1. Herkunftsland: EU/EFTA oder Drittstaat – Himmel oder Hölle
Woher du kommst, entscheidet fast alles.
Als EU/EFTA-Bürger kannst du relativ einfach starten. Doch Vorsicht: Spätestens nach 90 Tagen brauchst du eine Aufenthaltsbewilligung. Meist ist es der Ausweis B für Selbstständige. Dafür musst du deine Selbstständigkeit belegen – Rechnungen, Verträge, eigene Kunden. Und ja, ein Wohnsitz in der Schweiz gehört auch dazu.
Kommst du aus einem Drittstaat, wird es deutlich härter. Dann musst du mit einem Business-Plan überzeugen, nachweisen, dass du genug finanzielle Mittel hast, und zeigen, dass dein Business einen Nutzen für die Schweiz bringt.
Überraschend: Selbst EU-Bürger können abgelehnt werden, wenn sie keine echten Kundenbeziehungen vorweisen können.
2. Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen für Freelancer
„Ich hab doch schon Aufträge, das reicht doch.“ Leider nicht. Ohne die richtige Bewilligung geht gar nichts.
Die wichtigsten Bewilligungen im Überblick:
- L: Kurzaufenthalt bis 1 Jahr
- B: Aufenthalt ab 1 Jahr
- C: Niederlassung nach 5 Jahren
- G: Grenzgänger
Twist: Auch wenn du von Kunden schon gebucht bist, darfst du ohne gültige Bewilligung nicht einfach loslegen.
3. Steuern und Sozialversicherung für Freelancer in der Schweiz
Ab dem ersten Tag bist du steuerpflichtig, wenn dein Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt. Doppelbesteuerungsabkommen mit Ländern wie Deutschland können helfen – aber nur, wenn du sie aktiv einforderst.
Du musst dich selbst bei der AHV/IV/EO anmelden. Die Beiträge liegen je nach Einkommen zwischen 5,3 und 10 Prozent. Und ab einem Aufenthalt von mehr als einem Jahr ist eine Krankenversicherung Pflicht. Ausnahme: Du kannst nachweisen, dass deine ausländische Versicherung anerkannt wird.
Umsatzsteuer (MWST) gilt ab CHF 100’000 Umsatz. Kontraintuitiv: Selbst wenn du darunter liegst, lohnt sich die freiwillige Registrierung. Warum? Du wirkst seriöser gegenüber Kunden und kannst die Vorsteuer abziehen.
4. Unternehmensform und Buchhaltung: mehr als Formalitäten
Viele denken: „Einfach Rechnungen schreiben, das reicht.“ Doch so einfach macht es dir die Schweiz nicht.
Abhängig von Umsatz und Tätigkeit kann ein Eintrag ins Handelsregister notwendig sein. Und ein separates Geschäftskonto ist nicht Pflicht, aber dringend zu empfehlen – sonst verlierst du schnell den Überblick.
Geschäftsausgaben kannst du steuerlich absetzen. Doch nur, wenn du sie sauber dokumentierst.
Überraschend: Manche Auftraggeber akzeptieren nur Freelancer, die im Handelsregister eingetragen sind. Ein offizieller Eintrag kann dir also Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben.
5. Versicherungen und Absicherung für Freelancer
Als Freelancer trägst du das volle Risiko. Kein Lohnfortzahlungsanspruch, keine Ferien, keine Sicherheit.
Deshalb lohnt es sich, früh über zusätzliche Versicherungen nachzudenken. Besonders Unfall- und Invaliditätsversicherung, vielleicht sogar eine freiwillige Pensionskassenlösung.
Twist: Schweizer Kunden können Nachweise über deine Versicherungen verlangen. Nicht nur über deinen Freelancer-Status. Das klingt streng, gibt ihnen aber Sicherheit – und dir einen Vorteil bei der Auftragssuche.
6. Der Schweizer Kundenfaktor – Vertrauen schlägt alles
In der Schweiz zählen nicht nur Skills, sondern auch Vertrauen.
Viele Auftraggeber wollen die Sicherheit, dass du rechtlich sauber aufgestellt bist. Manche fragen aktiv nach Belegen: Wohnsitz, AHV-Nummer, Versicherungen.
Unkonventionell: Schweizer Kunden riskieren selbst Ärger, wenn dein Status unklar ist. Deshalb sind sie vorsichtiger, als du vielleicht denkst. Wer hier offen und transparent kommuniziert, punktet sofort.
7. Häufig übersehene Stolperfallen für Freelancer
Es sind oft nicht die grossen Dinge, die dich ausbremsen, sondern die Details.
- Die Annahme, dass kurze Einsätze keine Bewilligung brauchen.
- Das Übersehen kantonaler Unterschiede.
- Der fehlende Plan B, falls der Business-Plan nicht akzeptiert wird.
Überraschung: Selbst wenn du alles korrekt machst, kann eine fehlerhafte Meldung in deinem Kanton dein Projekt verzögern. Bürokratie klingt langweilig – wird aber schnell zum Showstopper.
8. Rechtliche Hilfe für ausländische Freelancer
Was tun, wenn du unsicher bist, ob deine Situation korrekt geregelt ist?
- AHV-Ausgleichskasse: erster Ansprechpartner für Fragen zu Selbstständigkeit und Sozialversicherung
- Kantonale Migrationsämter: zuständig für Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen
- Spezialisierte Anwälte: bei komplexen Fällen oder Drittstaaten-Bewerbungen besonders wertvoll
- Vorbereitung: Belege sammeln, etwa Rechnungen, Verträge, Nachweise zu Kundenbeziehungen und Marktauftritt
Ein kurzer Check bei der richtigen Stelle kann dir Jahre an Ärger und viele Franken an Kosten ersparen.
Fazit: Freiheit ja – aber nur mit Klarheit
In der Schweiz als Freelancer durchzustarten klingt nach Freiheit und Chancen. Doch ohne die richtigen Bewilligungen, Nachweise und Versicherungen kann aus diesem Traum schnell ein Albtraum werden.
Vielleicht hast du beim Lesen gedacht: „Das klingt kompliziert, vielleicht zu kompliziert.“ Genau dieses Gefühl haben viele am Anfang. Es ist normal, sich überfordert zu fühlen.
Die Wahrheit ist: Wer vorbereitet ist, hat die besten Karten. Mit klaren Strukturen, sauberen Verträgen, mehreren Kunden und der richtigen Absicherung öffnest du dir Türen, die anderen verschlossen bleiben.
Am Ende geht es nicht nur um Regeln, sondern um Vertrauen. Schweizer Kunden wollen Partner, die verlässlich und professionell auftreten. Wenn du das lieferst, steht deinem Erfolg nichts im Weg.
→ Nimm dir die Zeit, alles korrekt aufzusetzen. Das ist keine Last, sondern deine Eintrittskarte zu Freiheit, Stabilität und echten Chancen in der Schweiz.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
7 Wege, wie du als Freelancer in der Schweiz die typischen Stolperfallen vermeidest – und sogar Vorteile daraus machst
Einleitung
Du gehst voller Tatendrang in die Selbstständigkeit und stolperst plötzlich über Verträge, AHV oder Steuerfragen. Es fühlt sich an, als würdest du ständig an unsichtbaren Hürden hängenbleiben. Vielleicht denkst du dir: „Ich arbeite hart, aber irgendwie zieht mir das Drumherum die Energie.“
Dieses Gefühl ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Alltag im Freelancing. Genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen. Hier erfährst du, wie du typische Stolperfallen erkennst, ihnen ausweichst und sie sogar in echte Vorteile verwandelst.
1. Dokumentiere deine Selbstständigkeit wie ein Mini-Unternehmen
Selbstständigkeit zeigt sich nicht nur im Namen, sondern auch in den Details. Rechnungen mit eigener Nummerierung, ein Logo, eine Website und klare AGB. All das signalisiert Unabhängigkeit.
Es ist wie das Fundament eines Hauses: von aussen vielleicht unscheinbar, aber ohne geht alles ins Wanken. Wer seine Selbstständigkeit sichtbar macht, wird auch von der AHV oder SVA eher als Unternehmer akzeptiert.
2. Meide die Scheinselbstständigkeits-Falle durch Vielfalt
Die grösste Gefahr ist, wie ein Angestellter zu wirken. Feste Arbeitszeiten, dauernde Weisungen oder nur ein Kunde? Das schreit nach Ärger mit der AHV. Vielfalt schützt: mehrere Kunden, eigene Tools, unabhängige Arbeitsweise.
Kontraintuitiv, aber wahr: Manchmal ist „Nein“ sagen der klügste Schritt. Beispiel: Ein Auftraggeber verlangt tägliche Präsenz im Büro. Klingt lukrativ, wirkt aber schnell wie ein Angestelltenjob. Distanz bewahren spart später hohe Nachzahlungen.
>> Vertiefen: Scheinselbstständigkeit in der Schweiz: was Freelancer wissen müssen
3. Verträge – dein Schutzschild statt Pflichtübung
Ein Vertrag ist kein lästiger Papierkram, sondern dein Sicherheitsnetz. Klare Aufgaben, Rechte und Pflichten verhindern Missverständnisse. Rechnungen mit allen Pflichtangaben (fortlaufende Nummer, MWST-Infos) sind Pflicht, sonst droht Ärger mit dem Steueramt.
Überraschend wirksam: visuelle Verträge. Ein One-Pager mit Icons ist leichter zu verstehen als zehn Seiten Juristendeutsch. Kunden erinnern sich eher an das, was sie sehen. Und du vermeidest Streit über Kleinigkeiten.
4. Steuern und Finanzen – denk wie dein eigenes Finanzamt
Unregelmässige Einnahmen fühlen sich an wie eine Achterbahn. Ein Monat top, der nächste flop. Ein Budget glättet die Wellen. Rücklagen sind dein Sicherheitsseil. Tools wie Bexio oder Klara machen Zahlen transparent und erleichtern die MWST-Abrechnung.
Und hier der unerwartete Perspektivwechsel: Steuern sind nicht dein Feind. Sie sind ein Erfolgsmesser. Wer mehr zahlt, verdient auch mehr. Klingt schmerzhaft, ist aber die Wahrheit.
>> Vertiefen: So vermeiden Freelancer in der Schweiz die häufigsten Finanzfallen
5. Kundenakquise – nicht warten, bis das Telefon klingelt
Viele hoffen, dass die Aufträge von allein kommen. Doch Akquise ist wie Giessen: Ohne Wasser wächst keine Pflanze. Netzwerk pflegen, LinkedIn nutzen, Freelancer-Plattformen bespielen. Das schafft Stabilität.
Überraschend effektiv: die 10%-Regel. Reserviere konsequent ein Zehntel deiner Zeit für Akquise, auch wenn der Kalender voll ist. Heute säen bedeutet morgen ernten.
6. Kundenmanagement – Grenzen setzen ist Professionalität
„Scope Creep“ – wenn Kunden ständig Extras wollen – frisst Zeit und Nerven. Grenzen sind nicht unhöflich, sondern professionell.
Ein Beispiel: Du lieferst ein Design, und plötzlich will der Kunde zehn Varianten. Mit klaren Regeln und Pufferpreisen bleibst du souverän. Kleine Aufschläge machen Änderungswünsche entspannt statt stressig.
>> Auch interessant zu wissen: Wenn Kundenpläne kippen: So reagieren Schweizer Freelancer souverän auf kurzfristige Änderungen
7. Tools und Automatisierung – dein stilles Team im Hintergrund
Niemand muss alles allein stemmen. Buchhaltungstools, Projektsoftware, KI-Assistenten. Sie sind wie ein unsichtbares Team. Sie erledigen Routinen, während du dich auf das Wesentliche konzentrierst.
Kontraintuitiv, aber entscheidend: Automatisierung macht dich nicht unpersönlich, sondern schafft Raum für das Persönliche.
>> Lesetipp: Diese 7 Buchhaltungs-Tools sparen dir Zeit, Nerven und Geld
Bonus: Resilienz – denke wie ein Bergsteiger
Stolperfallen gehören zum Weg. Sie sind Trainingsstrecken, keine Sackgassen. Wer Rückschläge als Übung betrachtet, bleibt handlungsfähig. Resilienz ist wie ein Kletterseil – es hält dich, wenn du abrutschst, und gibt dir den Mut, weiterzugehen.
Am Ende zählt dein Weg
Vielleicht fühlst du dich nach all den Regeln, Formularen und Stolpersteinen wie in einem Labyrinth, in dem jede Abzweigung eine neue Überraschung bereithält. Manchmal sitzt du abends vor den Unterlagen und denkst: „Eigentlich wollte ich doch nur frei arbeiten und jetzt erdrückt mich der Papierkram.“ Dieses Gefühl ist real und es macht müde.
Doch genau hier liegt die Kraft. Du bist nicht machtlos. Du hast jetzt die sieben wichtigsten Hebel in der Hand. Verträge, die dich schützen. Finanzen, die dir Sicherheit geben. Kunden, die dich respektieren, weil du deine Grenzen setzt. Und Tools, die dich entlasten, statt dich zu fesseln.
Freelancing in der Schweiz ist kein Spiessrutenlauf. Es ist ein Aufstieg. Mit jedem Schritt wirst du stabiler, klarer, souveräner. Du bist kein Bittsteller, du bist Unternehmer. Kein Getriebener, sondern Gestalter.
Und wenn du das nächste Mal vor einer Stolperfalle stehst, erinnere dich. Sie ist kein Hindernis. Sie ist ein Sprungbrett. Bühne frei, jetzt ist dein Auftritt.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
10 Finanz-Tipps, die jeder Freelancer in der Schweiz kennen muss
Ganz ehrlich: Wer seine Finanzen als Freelancer in der Schweiz nicht im Griff hat, spielt Russisch Roulette mit seiner Selbstständigkeit. Klingt hart? Ist aber so. Steuern, AHV, Krankenkasse, Rechnungen – das Zeug erledigt sich nicht von allein.
Und Hand aufs Herz: Wie oft hast du schon gedacht, „Ach, das mach ich nächste Woche“ – und plötzlich stapeln sich Belege, Mahnungen flattern rein und du fühlst dich wie im Dauerstress? Willkommen im Alltag vieler Freelancer, die denselben Kampf mit Chaos und Aufschieberitis führen.
Die gute Nachricht: Es gibt einfache Schritte, mit denen du Kontrolle zurückholst – und zwar ohne dass dich die Bürokratie auffrisst. Lass uns die 10 wichtigsten anschauen.
1. Budget erstellen
Ein solides Budget ist wie ein Kompass. Es zeigt dir, wohin das Geld fließt – und wo es verschwindet. Plane nicht nur fixe Kosten wie Miete oder Versicherungen, sondern auch die kleinen Dinge: Kaffee unterwegs, Software-Abos, Zugtickets. Gerade die Kleinigkeiten reißen oft Löcher ins Konto. Ein Budget wirkt trocken, aber es ist das Fundament deiner Freiheit.
2. Liquidität sichern
Deine Einnahmen kommen in Wellen. Mal volle Auftragsbücher, mal Flaute. Wer in guten Monaten Rücklagen bildet, schläft in schlechten ruhiger. Stell dir vor, du packst jeden Monat 10 % deiner Einnahmen auf ein separates Konto. Klingt wenig, aber wenn ein Auftrag platzt, bist du froh über diesen Puffer.
3. Mehrere Einkommensquellen
Nur ein Kunde? Klingt bequem, ist aber riskant. Fällt er weg, stehst du da. Besser: mehrere kleinere Projekte, vielleicht sogar ein Side-Business. Ein Designer, der zusätzlich Workshops anbietet, lebt entspannter. Vielfalt macht dich stabiler.
4. Trennung von privat & geschäftlich
Vermischte Konten sind Gift. Du siehst nicht mehr, was Geschäft ist und was privat. Eine klare Trennung bringt Überblick – und schützt dich, wenn das Steueramt genauer hinschaut. Ein eigenes Geschäftskonto fühlt sich vielleicht bürokratisch an, macht aber vieles einfacher.
5. Digitale Tools einsetzen
Diese Schuhkartons voller Belege im Schrank? Schmeiß sie raus. Tools wie Bexio, Milkee oder ein digitales „Milchbüechli“ nehmen dir Arbeit ab. Rechnungen schreiben, Belege abfotografieren, Auswertungen ziehen – alles in einer App. Kontraintuitiv: Ein Tool spart dir nicht nur Zeit, es spart dir auch Fehler.
6. Buchführung zur Routine machen
Chaos entsteht nicht über Nacht. Es wächst langsam, mit jedem nicht gebuchten Beleg. Mach dir eine Gewohnheit daraus, einmal im Monat alles einzutragen. Stell dir den Moment vor, wenn du in 10 Minuten alles erledigt hast – statt stundenlang im Dezember zu fluchen.
7. Steuerpflicht im Griff behalten
Steuern sind kein Überraschungsei. Ab 100’000 CHF Umsatz bist du mehrwertsteuerpflichtig. Viele verdrängen das – bis das Schreiben vom Amt kommt. Kontraintuitiv: Wer Steuern rechtzeitig plant, hat am Ende mehr Ruhe und weniger Stress, selbst wenn’s weh tut.
8. Sozialversicherungen zahlen
AHV/IV/EO-Beiträge sind Pflicht. Zwischen 5,3 % und 10 % deines Einkommens. Klingt nach Abzug, ist aber deine Absicherung. Stell es dir wie einen Airbag vor: Hoffentlich brauchst du ihn nie – aber wenn, dann rettet er dir die Existenz.
9. Vorsicht Scheinselbstständigkeit
Du bist Freelancer, aber arbeitest wie ein Angestellter? Einziger Kunde, feste Arbeitszeiten, Weisungen? Dann wird’s kritisch. Das Risiko: Nachzahlungen und rechtliche Folgen. Lieber rechtzeitig klären, statt böse Überraschungen erleben.
10. Hilfe holen, wenn nötig
Niemand muss alles allein stemmen. Ein Treuhänder oder Finanzexperte kostet Geld, aber erspart dir schlaflose Nächte. Manchmal ist es klüger, loszulassen und Profis ran zu lassen – genau dann, wenn dir die Zahlen langsam den Atem nehmen.
Extra: Altersvorsorge nicht vergessen
Viele Freelancer blenden sie gern aus, weil das Thema weit weg wirkt: die Rente. Doch gerade die 3. Säule in der Schweiz gibt dir die Chance, privat vorzusorgen und gleichzeitig Steuern zu sparen. Heute einzahlen, morgen profitieren – ein kleiner Hebel mit großer Wirkung.
Finanzen im Griff – wenn plötzlich alles leichter wirkt
Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst: „Okay, klingt alles schön und gut – aber wo fang ich bloß an?“ Genau dieses Gefühl ist normal. Die endlosen Zahlen, Belege und Paragraphen können einem wie ein Berg vorkommen, den man niemals hochkommt. Und ja, es nervt, wenn man eigentlich arbeiten will, aber ständig die Finanzen im Nacken sitzen.
Doch genau hier liegt deine Chance. Du hast jetzt einen Plan. Zehn einfache Schritte, die dir helfen, Klarheit reinzubringen. Kein Chaos mehr, das dich nachts wachhält. Stattdessen Struktur, Überblick und die Gewissheit, dass du nicht von der nächsten Rechnung oder Steuerforderung überrollt wirst.
Stell dir vor, du öffnest dein Konto und weißt: Alles ist im Lot. Dein Budget stimmt, deine Rücklagen geben dir Ruhe, deine Buchhaltung läuft. Dieses Gefühl – Freiheit statt Druck – ist unbezahlbar.
Und das Beste: Du musst kein Finanzprofi sein, um das zu schaffen. Nur anfangen. Ein Schritt heute, ein weiterer nächste Woche – und plötzlich merkst du, wie der Berg kleiner wird.
Am Ende geht es nicht um Zahlen. Es geht darum, dir selbst Sicherheit zu schenken. Damit du arbeiten, leben und wachsen kannst – ohne dass dir ständig die Angst im Nacken sitzt. Also: Hol dir die Kontrolle zurück. Es ist deine Selbstständigkeit, dein Erfolg, deine Freiheit.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Freelancer-Fallen: Die häufigsten Gesundheitsrisiken (und was du sofort dagegen tun kannst)
Freiheit, Selbstbestimmung, keine Chefs im Nacken – klingt nach Traumjob, oder? Und doch erwischst du dich manchmal dabei, wie du nachts wachliegst und denkst: „Eigentlich hab’ ich mir das anders vorgestellt.“ Zwischen Kundenprojekten, Deadlines und der Familie bleibt kaum Luft zum Durchatmen. Klar, nach aussen läuft alles: Aufträge rein, Rechnungen raus. Aber heimlich fragst du dich, wie lange dein Körper und Kopf das Tempo noch mitmachen. Genau da setzen wir an: In diesem Artikel findest du die grössten Gesundheitsfallen für Freelancer – und vor allem die Hacks, mit denen du dich clever davor schützt.
Die häufigsten Gesundheitsrisiken für Freelancer
1. Stress & Überforderung: die stille Berufskrankheit
Über die Hälfte der Freelancer in Deutschland berichten von psychischen Problemen und Burnout-Symptomen. Ständiger Leistungsdruck, finanzielle Unsicherheit und das Jonglieren mehrerer Projekte erzeugen ein Dauer-Highspeed-Gefühl – wie Autofahren mit Vollgas ohne Bremse. Kurzfristig pusht es, langfristig macht es krank.
2. Schlechte Ergonomie: der unsichtbare Saboteur
Ein Küchenstuhl ersetzt keinen Bürostuhl. Wer stundenlang krumm über dem Laptop hängt, spürt es irgendwann: steifer Nacken, flimmernde Augen, Rückenschmerzen. Ein ergonomischer Arbeitsplatz
macht am Ende den Unterschied zwischen beschwerdefreiem Arbeiten und Dauerschmerzen.
3. Schlafstörungen: wenn der Laptop wie eine Nachttischlampe flackert
Flexible Arbeitszeiten kippen schnell ins Chaos. Deadlines rücken näher, der Rechner bleibt bis Mitternacht offen. Die Folge: ein aus dem Takt geratener Schlafrhythmus. Laut Schweizer Gesundheitsumfragen waren 2022 bereits 30,3 % der Erwerbstätigen emotional erschöpft – Schlafdefizite sind einer der grössten Treiber. Feste Routinen helfen, gegenzusteuern.
4. Work-Life-Balance: Grenzen verschwimmen
E-Mails beim Abendessen, Telefonate am Wochenende. Erst Ausnahme, dann Gewohnheit. Irgendwann stellt sich die Frage: Wann habe ich das letzte Mal wirklich Pause gemacht? Genau dieses „Präsent-Sein“ rund um die Uhr erhöht nachweislich das Risiko für Burnout – besonders bei Selbstständigen. Mehr dazu hier: Als Freelancer fehlt dir keine Zeit, sondern Fokus
5. Vorsorge-Defizite: Prävention wird zur Kostenfalle
Arzttermine verschoben, Check-ups gestrichen. Kontraintuitiv, weil genau das langfristig teuer wird. Prävention kostet weniger als Krankheit – und doch wird sie von Freelancern am häufigsten vernachlässigt. Lies dazu auch: Selbstständig und krank: Was Freelancer in der Schweiz wissen müssen
Prävention im Alltag: So bleibst du gesund
A) Sofortmassnahmen für deinen Alltag
- Ergonomie first: höhenverstellbarer Tisch, guter Stuhl, Tageslicht – kleine Investitionen, grosse Wirkung.
- Aktive Pausen: Pomodoro, Spaziergang, Dehnen – statt zwölf Stunden am Stück durchzupowern.
- Feste Routinen: Arbeits- und Schlafzeiten stabilisieren die innere Uhr.
- Freizeit blocken: Termin im Kalender, so verbindlich wie ein Kundencall.
B) Organisation & Absicherung – dein Sicherheitsnetz
- Rücklagen: Drei bis sechs Monatsgehälter geben Luft zum Atmen. Lies hier weiter: Finanzielle Sicherheit für Freelancer.
- Versicherungen: Krankenversicherung, Krankentagegeld, BU – unspektakulär, aber essenziell.
- Vertretungspartner: Netzwerke mit anderen Freelancern, damit Kunden auch im Krankheitsfall betreut sind.
C) Mentale Stärke – dein unsichtbares Kapital
- Stressmanagement: Meditation, Sport, bewusste Atempausen.
- Klare Kommunikation: Verfügbarkeit begrenzen, Grenzen setzen. „Nein“ ist kein Scheitern, sondern Selbstschutz.
Extra-Tipp: Die etwas anderen Gesundheits-Hacks
Coworking-Spaces wirken kontraintuitiv: lauter, unruhiger? Oft das Gegenteil. Ergonomische Möbel, Austausch mit anderen, feste Öffnungszeiten – Struktur, die gesund macht. Viele Krankenkassen in der Schweiz bieten digitale Präventionskurse, die kaum jemand nutzt. Wer sich darauf einlässt, entdeckt überraschend wirksame Strategien.
Zeit, wieder durchzuatmen
Vielleicht kennst du das: Der Kopf rattert wie ein voller Server, die To-do-Liste wächst schneller, als du sie abhaken kannst, und selbst wenn du Feierabend machst, fühlt es sich nicht nach Feierabend an. Du denkst: „Wie soll ich das alles noch stemmen, ohne dabei völlig auszubrennen?“ – und genau da spürst du, wie sehr dich das Ganze drückt.
Und weißt du was? Es ist okay, dass es sich manchmal schwer anfühlt. Du bist nicht schwach, nur weil dir die Balance entgleitet. Du bist einfach ein Mensch, der viel trägt.
Aber: Du musst nicht im Dauerlauf durchs Leben hetzen. Stell dir vor, wie es ist, wenn dein Rücken entspannt ist, dein Schlaf erholsam, dein Konto nicht bei jeder Flaute Panik auslöst. Genau das steckt in den kleinen Schritten, über die wir gesprochen haben: Ein ergonomischer Arbeitsplatz, feste Routinen, Rücklagen, ein Netzwerk. Sie sind keine Luxus-Extras – sie sind dein Rettungsboot.
Es geht nicht darum, alles sofort perfekt umzusetzen. Es reicht, wenn du heute den ersten Stein ins Rollen bringst. Pausen blocken, „Nein“ sagen, einen Check-up vereinbaren. Jeder kleine Schritt schenkt dir ein Stück Freiheit zurück.
Denn am Ende bist nicht du für deine Arbeit da – deine Arbeit ist für dich da. Und deine Gesundheit ist das Kapital, das alles trägt. Also: Fang an. Heute. Hier. Jetzt.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Warum Fokus wichtiger ist als Zeit – und wie du ihn trainierst
1. Einleitung
Zeitmanagement? Klingt nett, bringt dir aber selten das, was du wirklich willst: echte Ergebnisse. Du kannst noch so viele Stunden ackern – wenn dein Kopf ständig zwischen E-Mails, Calls und To-dos springt, bleibt am Ende nur dieses ausgelaugte Gefühl: viel gemacht, aber nichts geschafft. Kennst du das? Dieses heimliche „Ich strample wie verrückt, aber komme keinen Zentimeter vorwärts“. Genau darin steckt die eigentliche Wahrheit: Nicht Zeit ist dein knappstes Gut, sondern Fokus. Und der entscheidet, ob du untergehst oder wirklich etwas bewegst. In diesem Artikel zeige ich dir, warum Fokus mehr wert ist als jede Überstunde – und wie du ihn Schritt für Schritt in deinen Alltag holst.
2. Konventionelle Ansätze – und warum sie scheitern
Der erste Reflex vieler Menschen: mehr Zeit investieren. Später anfangen, länger machen, am Wochenende noch schnell die To-do-Liste durchziehen. Doch mehr Stunden bedeuten nicht automatisch mehr Ergebnisse. Im Gegenteil: Müdigkeit setzt ein, Fehler schleichen sich ein, und das Gefühl von „ich schaffe es nie“ wird lauter.
Dann gibt es das große Versprechen des Multitaskings. Klingt modern, wirkt effizient – ist es aber nicht. Wer parallel E-Mails beantwortet, im Zoom-Call nickt und nebenbei ein Konzept schreibt, springt ständig hin und her. Jeder Kontextwechsel kostet Energie. Am Ende bleibt ein Sammelsurium halbfertiger Aufgaben.
Auch klassisches Zeitmanagement stößt an Grenzen. Kalendertricks und To-do-Listen verwalten zwar die Zeit, nicht aber die Aufmerksamkeit. Es fühlt sich organisiert an, doch der Kern des Problems – fehlender Fokus – bleibt bestehen.
3. Warum Fokus überlegen ist
Fokus wirkt wie ein Verstärker. In Momenten tiefer Konzentration steigt die Produktivität um bis zu 28 %. Weniger Ablenkung bedeutet nicht nur schnelleres Arbeiten, sondern auch gründlicheres.
Qualität schlägt Quantität. Wer voll konzentriert eine Aufgabe erledigt, macht weniger Fehler und kommt auf bessere Ideen. Das Ergebnis ist nicht nur schneller da, sondern auch wertvoller.
Fokus reduziert Stress. In klar abgegrenzten Phasen entsteht Flow. Dieses Gefühl, wenn du so vertieft bist, dass du den Kaffee neben dir kalt werden lässt und die Welt kurz stillsteht. Statt Erschöpfung bleibt Zufriedenheit zurück.
Und schließlich: Fokus schenkt Sinn. Es geht nicht nur um erledigte Aufgaben, sondern um Wirkung. Menschen sehnen sich danach, am Ende des Tages tatsächlich etwas bewegt zu haben – Fokus ist dafür der Schlüssel.
4. Attention Management: Warum es Zeitmanagement ablöst
Der Schlüssel liegt darin, nicht die Zeit, sondern die Aufmerksamkeit zu steuern. Fokus ist ein Muskel. Er wächst, wenn er regelmäßig trainiert wird.
Kurze, intensive Fokusphasen sind oft effektiver als stundenlanges Arbeiten. Zwei Stunden tiefes Eintauchen bringen mehr als acht Stunden oberflächliches Herumhüpfen zwischen Tasks.
Hilfreiche Tools sind Deep-Work-Sessions, Apps zur Ablenkungsblockade oder einfache „Do-Not-Disturb“-Zeiten. Wer sie konsequent einsetzt, baut eine Struktur, die schützt.
Gerade für Freelancer oder KMU-Profis reicht es oft, zwei bis drei Stunden „Peak Work“ einzuplanen. In dieser Zeit entstehen die wichtigsten Ergebnisse – der Rest darf einfacher laufen.
5. Gegenargumente – und warum sie nicht halten
„Ich brauche viele Stunden, sonst schaffe ich nichts.“ Ein Irrglaube. Ohne Fokus verpuffen Stunden wie Rauch im Wind.
„Meine Kunden erwarten ständige Erreichbarkeit.“ In Wahrheit sorgt klare Kommunikation für mehr Vertrauen. Wer feste Zeitfenster setzt, wirkt verlässlich, nicht faul.
„Ich bin kein konzentrierter Typ.“ Fokus ist kein Talent, sondern Training. Jeder kann lernen, die eigene Aufmerksamkeit zu bündeln – Schritt für Schritt.
Zeit, das Steuer zurückzuholen
Vielleicht kennst du diesen Moment: Du hast zehn Dinge angefangen, drei beendet, sieben halb offen – und trotzdem fühlt es sich an, als wärst du keinen Meter vorangekommen. Der Kopf rauscht, die To-do-Liste lacht dich aus, und innerlich fragst du dich: „Wofür eigentlich der ganze Stress, wenn am Ende so wenig hängenbleibt?“
Und genau da liegt der Kern. Es ist nicht deine Zeit, die fehlt. Es ist der Fokus, der zerbröselt. Und das ist kein Makel, sondern ein Muster – eins, das du durchbrechen kannst.
Stell dir vor, wie es ist, wenn du Ablenkungen abstreifst wie Ballast. Wenn du statt im Nebel zu stolpern klar siehst, was wirklich zählt. Weniger Hektik, mehr Wirkung. Weniger Chaos, mehr Sinn. Genau dafür ist Fokus da: Er macht aus denselben Stunden Ergebnisse, die tragen.
Du hast es in der Hand. Nicht irgendwann, nicht „wenn’s mal ruhiger wird“. Heute. Fang mit einer Sache an, der wichtigsten. Alles andere darf warten.
Denn Zeit ist nur die Bühne – der Applaus kommt vom Fokus. Und den kannst du dir jetzt holen. Starte hier auf Freelancer-Schweiz.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Freelancer, Solopreneur oder Selbstständig? – Finde deinen Weg
Bist du Freelancer, Solopreneur oder einfach nur selbstständig – und weisst du wirklich, was das für dein Einkommen und deinen Alltag bedeutet? Viele nutzen die Begriffe synonym, doch sie stehen für unterschiedliche Modelle. Wer die Unterschiede kennt, kann sein Business bewusster gestalten – und Klarheit über die nächsten Schritte gewinnen.
Freelancer: Flexibel, aber abhängig von deiner Zeit
Ein Freelancer arbeitet projektbezogen für verschiedene Kunden und verkauft seine Zeit gegen Honorar. Typisch sind zeitlich begrenzte Aufträge, oft in Beratungs- oder kreativen Branchen.
- Stärken: Flexibilität, Abwechslung, direkter Kundenkontakt.
- Grenzen: Dein Einkommen ist unmittelbar an deine Arbeitszeit gebunden.
Solopreneur: Geschäft auf Autopilot – wenn du es richtig aufbaust
Ein Solopreneur baut als Einzelperson ein Unternehmen auf, das unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert – häufig durch digitale Produkte oder automatisierte Dienstleistungen.
- Stärken: Hohe Skalierbarkeit, Einkommensquellen auch ohne deine direkte Arbeitszeit.
- Grenzen: Erfordert strategischen Aufbau, Systemdenken und oft längeren Atem.
Selbstständig: Der grosse Überbegriff
„Selbstständig“ beschreibt alle, die eigenverantwortlich arbeiten – vom Einzelunternehmer über Freelancer bis zum Solopreneur. Hier steht das Unternehmertum im Vordergrund: Buchhaltung, Akquise, Steuern, Verantwortung für das Ganze.
- Stärken: Maximale Freiheit, eigene Entscheidungen.
- Grenzen: Hohe Verantwortung und administrativer Aufwand.
Unterschiede im Überblick
| Merkmal | Freelancer | Solopreneur | Selbstständig |
|---|---|---|---|
| Geschäftsmodell | Projekte gegen Zeit | Skalierbare Produkte/Dienstleistungen | Überbegriff für eigenständige Tätigkeit |
| Mitarbeiter | Keine | Keine | Möglich, aber nicht zwingend |
| Fokus | Auftragsarbeit für Kunden | Unternehmertum, Automatisierung | Unternehmerisches Handeln allgemein |
| Beispiel | Grafikdesigner:in | Onlinekurs-Anbieter:in | Steuerberater:in mit eigener Kanzlei |
Fazit: Dein Modell bewusst wählen
Jedes Modell betont einen anderen Aspekt eigenständiger Arbeit:
- Freelancer: Du tauschst Zeit gegen Geld.
- Solopreneur: Dein Geschäft wächst auch ohne dich.
- Selbstständig: Der Oberbegriff für alle, die ihr eigenes Business führen.
→ Und jetzt zu dir: Wo siehst du dich aktuell – Freelancer, Solopreneur oder Selbstständig?
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Freelancer in der Schweiz werden: 7 Schritte für Nebenjob & Vollzeit
Viele träumen davon, Freelancer zu werden – eigene Kunden, mehr Freiheit, flexibler arbeiten. Doch in der Schweiz hat die Selbstständigkeit auch ihre Tücken: Sozialversicherungen, Steuern, Handelsregister. Wer die Regeln nicht kennt, zahlt am Ende drauf. Die gute Nachricht: Mit den richtigen Schritten ist der Start machbar – ob nebenbei oder hauptberuflich.
1. Geschäftsidee und Zielkunden festlegen
Definiere, was du anbietest – und für wen. Je klarer deine Positionierung, desto leichter gewinnst du Kunden.
Beispiel: Anna arbeitet 80 Prozent im Marketing und übernimmt nebenbei Grafikprojekte für KMU. Ihr Vorteil: Sie weiss genau, welche Firmen ihr Know-how brauchen.
2. Freelancer-Status bei der AHV bestätigen
Die AHV stuft dich nur als selbstständig ein, wenn du für mehrere Kunden arbeitest. Drei Aufträge von unterschiedlichen Auftraggebern sind ein guter Richtwert. Rechnungen und Verträge dienen als Nachweis. Das schützt dich auch vor dem Vorwurf der Scheinselbstständigkeit.
3. Die passende Rechtsform wählen
Für den Start reicht meist ein Einzelunternehmen. Es ist günstig und unkompliziert.
Wenn dein Umsatz steigt oder du Partner an Bord holst, kann eine GmbH sinnvoll sein – besonders, um persönliche Risiken zu begrenzen.
4. AHV, Handelsregister und MWST anmelden
- AHV: Verdientst du mehr als 2’300 CHF im Jahr, musst du dich bei der Sozialversicherung anmelden – egal ob neben- oder hauptberuflich.
- Handelsregister: Eintrag ab 100’000 CHF Umsatz oder wenn du ein kaufmännisches Gewerbe betreibst.
- Mehrwertsteuer: Pflicht ab 100’000 CHF Umsatz mit MWST-pflichtigen Leistungen.
5. Buchhaltung organisieren
Bis 100’000 CHF Umsatz genügt eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
Ab dann ist eine doppelte Buchhaltung sinnvoll – nicht nur fürs Gesetz, sondern auch, um jederzeit den Überblick zu behalten.
6. Nebenberuflich oder hauptberuflich starten
- Nebenberuflich: Viele beginnen klein. Kläre mit deinem Arbeitgeber, ob er einverstanden ist. Einnahmen über 2’300 CHF musst du der AHV melden.
- Hauptberuflich: Dann wird es ernster: Kranken- und Unfallversicherung, Taggeld, Vorsorge – alles liegt in deiner Verantwortung. Wer hier früh plant, verhindert Lücken.
7. Steuern im Griff haben
Jedes Einkommen aus Freelance-Arbeit musst du in der Steuererklärung angeben. Du zahlst AHV/IV/EO-Beiträge selbst – und zwar regelmässig. Plane diese Kosten von Anfang an ein, damit du keine bösen Überraschungen erlebst.
Zusammenfassung: Checkliste Freelancer Schweiz
- Geschäftsidee definieren → Kunden gewinnen
- AHV-Anmeldung ab 2’300 CHF Umsatz
- Handelsregister & MWST ab 100’000 CHF Umsatz
- Buchhaltung organisieren
- Steuern & Versicherungen frühzeitig planen
Mit diesen Schritten schaffst du die Grundlage für deinen erfolgreichen Start als Freelancer in der Schweiz. Klarheit, Planung und ein Blick für die Formalitäten – so baust du dir deine Selbstständigkeit sicher auf.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Nebentätigkeit in der Schweiz: 6 Regeln, um Konflikte mit dem Arbeitgeber zu vermeiden
Wir haben kürzlich folgende E-Mail erhalten:
„Ich habe in der Vergangenheit als Freelancer gearbeitet. Jetzt bin ich in Festanstellung und arbeite nebenberuflich gelegentlich für alte Kunden. Was muss ich beachten?“
Genau diese Frage stellen sich viele Arbeitnehmende in der Schweiz.
Ein Nebenjob kann spannend und lukrativ sein – er bringt aber auch rechtliche Fallstricke mit sich.
Wer unvorbereitet loslegt, riskiert Ärger mit dem Arbeitgeber, im schlimmsten Fall sogar eine Kündigung.
Diese sechs Regeln helfen dir, Konflikte zu vermeiden.
1. Treuepflicht: Dein Nebenjob darf kein Konkurrenzgeschäft sein
Die wichtigste Grundregel ist die Treuepflicht. Dein Arbeitgeber darf erwarten, dass du seine Interessen schützt.
Das heisst: keine Kunden abwerben, keine vergleichbaren Leistungen für Konkurrenten anbieten und nichts tun, was dem Ruf des Unternehmens schadet.
Wer dagegen verstösst, verletzt den Arbeitsvertrag.
2. Arbeitsleistung im Hauptjob sichern
Dein Nebenjob darf nicht dazu führen, dass du im Hauptjob weniger leistungsfähig bist.
Übermüdung, verpasste Termine oder Unkonzentriertheit sind Warnsignale.
Achte darauf, dass du beide Tätigkeiten sauber trennen kannst – deine Energie im Hauptjob ist ausschlaggebend.
3. Maximalarbeitszeit beachten: So bleibst du gesetzeskonform
Das Arbeitsgesetz setzt klare Grenzen: Haupt- und Nebenjob zusammen dürfen die gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit nicht überschreiten.
Je nach Branche liegt diese bei 45 bis 50 Stunden pro Woche.
Ein Verstoss kann nicht nur für dich, sondern auch für deinen Arbeitgeber rechtliche Folgen haben.
4. Arbeitgeber informieren und Zustimmung einholen
Viele Arbeitsverträge enthalten eine Informations- oder Bewilligungspflicht für Nebentätigkeiten.
Prüfe deine Unterlagen sorgfältig: Manchmal reicht eine Meldung, manchmal brauchst du eine schriftliche Genehmigung.
Transparenz ist der beste Weg, um Streit zu vermeiden.
Wenn du unsicher bist, hol dir die Zustimmung deines Arbeitgebers schriftlich.
5. Spezielle Situationen im Blick behalten
Nebentätigkeit während Ferien oder Krankheit ist grundsätzlich tabu.
In der Ferienzeit steht die Erholung im Vordergrund, bei Krankheit die Genesung.
Klär ausserdem, wie viel Zeit du in deinen Nebenjob stecken darfst und welche Tätigkeiten erlaubt sind.
Dokumentiere diese Punkte – das verhindert Missverständnisse.
6. Praktische Tipps für einen konfliktfreien Nebenjob
- Arbeitsvertrag und Reglemente genau lesen: Gibt es Konkurrenzklauseln oder Bewilligungspflichten?
- Keine Kundenlisten, Betriebsgeheimnisse oder Ressourcen deines Arbeitgebers für den Nebenjob verwenden.
- Frühzeitig kommunizieren, wenn Überschneidungen drohen – offene Gespräche schaffen Vertrauen.
- Versicherungen prüfen: Bei Unfällen im Nebenjob gilt nicht automatisch die gleiche Deckung wie im Hauptjob.
Kurz & knapp: Checkliste
- Kein Wettbewerb zum Arbeitgeber
- Hauptjob-Leistung sichern
- Maximalarbeitszeit einhalten
- Arbeitgeber informieren und ggf. Bewilligung einholen
- Ferien & Krankheit sind tabu für Nebenjobs
- Grenzen klären und dokumentieren
Wer sich an die Regeln hält, schafft die Basis für Vertrauen – und profitiert doppelt: vom sicheren Hauptjob und spannenden Projekten nebenbei.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Nebenberuflich selbstständig? So meldest du deine Tätigkeit korrekt bei der AHV an
Viele glauben, kleine Nebeneinnahmen müsse man gar nicht melden.
Doch Vorsicht: Wer die Anmeldung bei der AHV zu lange hinauszögert, riskiert Nachzahlungen und Ärger mit der Ausgleichskasse.
Dabei ist der Prozess überschaubar – wenn man die Schritte kennt.
Hier erfährst du, wie du deine nebenberufliche Tätigkeit korrekt bei der AHV anmeldest und so auf der sicheren Seite bleibst.
1. AHV-Pflicht prüfen: Ab wann musst du deine Nebentätigkeit anmelden?
Die Anmeldung wird verpflichtend, sobald dein Jahresgewinn über 2’300–2’500 CHF liegt.
Verdient eine Fotografin beispielsweise 3’000 CHF pro Jahr mit Aufträgen, muss sie sich anmelden.
Liegt dein Gewinn darunter, ist die Anmeldung freiwillig – aber empfehlenswert, weil sie deine Beiträge für die spätere Rente sichert.
2. Zuständige Ausgleichskasse wählen
Die Anmeldung erfolgt entweder bei der kantonalen Ausgleichskasse am Wohn- oder Geschäftssitz.
Oder bei einer Verbandsausgleichskasse, wenn du Mitglied in einem Berufsverband bist.
Wichtig ist, dass du die passende Kasse frühzeitig kontaktierst.
3. AHV-Anmeldeformular: So füllst du es richtig aus
Das Formular findest du direkt auf der Website deiner Ausgleichskasse.
Lade es herunter, fülle es aus und reiche es so schnell wie möglich ein – am besten im ersten Quartal nach Start deiner Nebentätigkeit.
So vermeidest du Verzögerungen bei der Beitragsabrechnung.
4. Unterlagen einreichen: Das solltest du beilegen
Die Ausgleichskasse möchte sehen, dass du tatsächlich selbstständig arbeitest. Typische Nachweise sind:
- Rechnungen an Kunden
- Kopien von Verträgen
- Ausgaben- oder Investitionsbelege
- Werbematerial wie Website, Preislisten oder Visitenkarten
- Wichtig: Meist wird erwartet, dass du bereits Aufträge ausgeführt hast.
5. Statusprüfung abwarten
Die Ausgleichskasse prüft deine Unterlagen und entscheidet, ob du die Voraussetzungen für Selbstständigkeit erfüllst.
Den Bescheid erhältst du schriftlich.
Damit hast du Klarheit, ob deine Nebentätigkeit offiziell anerkannt ist.
6. Beitragsrechnung erhalten und rechtzeitig zahlen
Nach der Anerkennung erhältst du eine Beitragsrechnung. Grundlage ist dein gemeldeter Gewinn:
- Unter 10’100 CHF: Mindestbeitrag.
- Über 10’100 CHF: proportionaler Beitragssatz.
7. Spezialfall: Gewinn unter 2’300–2’500 CHF
Bleibt dein Gewinn darunter, ist die Anmeldung freiwillig.
Sie lohnt sich trotzdem – vor allem für deine Rentenansprüche.
Wer bereits einen AHV-pflichtigen Lohn aus seiner Festanstellung hat, kann in bestimmten Fällen reduzierte Beiträge zahlen.
Kurz & knapp: Checkliste AHV-Anmeldung
- Gewinn prüfen: über 2’300 CHF → Pflicht
- Zuständige Ausgleichskasse wählen
- Formular herunterladen und einreichen
- Nachweise beilegen
- Entscheid abwarten → Beitragsrechnung fristgerecht zahlen
Fazit: Viele Nebenerwerbstätige unterschätzen die Bedeutung der AHV-Anmeldung.
Wer aber frühzeitig handelt, schafft Rechtssicherheit, vermeidet Nachzahlungen und sorgt dafür, dass seine Einkünfte in die spätere Rente einfliessen.
So bleibt dein Nebenjob ein Gewinn – nicht nur finanziell, sondern auch fürs gute Gefühl, alles korrekt geregelt zu haben.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Selbständigerwerbender anmelden: Diese Unterlagen brauchst du für die AHV
Viele Gründer sind überrascht, welche Belege die AHV tatsächlich sehen will.
Ein einfaches Formular reicht in der Regel nicht – die Ausgleichskasse prüft genau, ob du wirklich selbstständig arbeitest und ein eigenes Risiko trägst.
Wer seine Unterlagen von Anfang an sauber vorbereitet, spart Zeit und erhält den Status deutlich schneller.
Hier erfährst du, welche Unterlagen du brauchst und wie du deine Anmeldung überzeugend gestaltest.
1. Anmeldeformular vorbereiten
Der erste Schritt ist das Formular für Selbständigerwerbende, erhältlich bei deiner kantonalen oder einer Verbandsausgleichskasse.
Lade es herunter, fülle es aus und reiche es frühzeitig ein – idealerweise innerhalb des ersten Quartals nach Aufnahme deiner Tätigkeit.
2. Erste Kundenbelege einreichen
Zeige, dass du bereits Aufträge hast.
Geeignet sind Rechnungen oder Offerten, die du an Kundinnen und Kunden gestellt hast, oder unterschriebene Verträge mit Auftraggebern.
Beispiel: Eine Grafikerin, die nach Feierabend Logos gestaltet, reicht ihre ersten zwei Rechnungen und eine unterschriebene Offerte ein.
Damit ist klar: Sie arbeitet eigenständig am Markt.
3. Eigenkapital und Investitionen für die AHV belegen
Die Kassen wollen sehen, dass du unternehmerisches Risiko trägst.
Reiche deshalb Quittungen über Anschaffungen oder Ausgaben ein – zum Beispiel für Software, Arbeitsmaterial oder Marketing.
4. Werbematerial als Beleg für Selbstständigkeit einreichen
Selbstständigkeit bedeutet, sichtbar zu sein.
Visitenkarten, Flyer, Prospekte oder der Link zu deiner Website signalisieren, dass du aktiv Kunden suchst.
Auch ein professionelles Online-Profil kann hilfreich sein.
5. Geschäftsinfrastruktur dokumentieren
Falls vorhanden, lege den Mietvertrag für Geschäftsräume bei.
Auch ein Nachweis über einen Co-Working-Platz oder eigene Ausstattung unterstützt deine Glaubwürdigkeit.
6. Geschäftsidentität zeigen
Kleinigkeiten zählen.
Firmenbriefpapier oder formale Angebotsschreiben zeigen, dass du nicht nur gelegentlich Aufträge erledigst, sondern ein eigenes Geschäft führst.
7. Versicherungsnachweis (falls nötig)
In einigen Branchen oder Kantonen wird ein Haftpflichtversicherungsnachweis verlangt.
Prüfe, ob deine Tätigkeit dazugehört.
8. Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung ergänzen
Eine einfache Übersicht deiner Einnahmen und Ausgaben hilft der Ausgleichskasse bei der Beurteilung.
Sie zeigt deine Ernsthaftigkeit.
Tipps für eine schnelle Anerkennung
Reiche die Anmeldung frühzeitig ein – am besten im ersten Quartal nach Start.
Je mehr Unterlagen du einreichst, desto schneller wird dein Status bestätigt.
Beachte: Details können je nach Kanton leicht variieren.
Kurz & knapp: Checkliste Unterlagen
- Anmeldeformular
- Rechnungen oder Verträge
- Nachweise für Investitionen
- Werbematerialien
- Geschäftsräume (falls vorhanden)
- Firmenbriefpapier
- Versicherungsnachweis (je nach Branche)
- Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung
Fazit: Viele unterschätzen, wie gründlich die AHV die Selbstständigkeit prüft.
Wer aber von Anfang an die richtigen Unterlagen einreicht, schafft Rechtssicherheit, spart wertvolle Zeit – und kann sich schneller auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Kunden gewinnen und das eigene Geschäft entwickeln.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Freelancer-Rechnung in der Schweiz: So schreibst du sie richtig (inkl. Pflichtangaben & Muster)
Du hast deinen Auftrag abgeschlossen – jetzt kommt der Moment, auf den du gewartet hast: die Rechnung.
Doch Achtung: Schon kleine Fehler können dazu führen, dass Kunden die Zahlung verzögern oder die Steuerbehörden Nachfragen stellen.
Eine saubere Rechnung ist dein Schlüssel zu schneller Bezahlung und professionellem Auftreten. Hier erfährst du, welche Pflichtangaben dazugehören, welche Details zusätzlich sinnvoll sind und wie ein Muster aussieht.
1. Pflichtangaben auf jeder Freelancer-Rechnung
Damit deine Rechnung rechtlich gültig ist, müssen bestimmte Angaben enthalten sein:
- Name und Adresse des Rechnungsstellers: Dein Name, Adresse, optional Firmenname.
- Name und Adresse des Kunden: Ab 400 CHF zwingend erforderlich.
- Rechnungsnummer: Fortlaufend, eindeutig – wichtig für Steuerprüfungen.
- Rechnungsdatum: Datum der Ausstellung.
- Leistungsbeschreibung: Klarer Beschrieb der Leistung(en) und Zeitraum, falls abweichend vom Rechnungsdatum.
- Betrag und Währung: Endbetrag in CHF.
- Mehrwertsteuer: Falls MWST-pflichtig mit MWST-Nummer und Steuersatz; sonst Hinweis „nicht MWST-pflichtig“.
- Zahlungsfrist & Zahlungsinformationen: Z. B. „zahlbar innert 30 Tagen“, IBAN oder Bankverbindung.
2. Weitere Angaben, die Professionalität zeigen
Neben den Pflichtangaben lohnt es sich, auch diese Infos einzubauen:
- Firmenlogo für einen professionellen Auftritt.
- UID oder MWST-Nummer, wenn vorhanden.
- Rechnungspositionen statt nur Gesamtbetrag – sorgt für Klarheit.
3. Rechnungen in der Schweiz: Praktische Hinweise für Freelancer
- Keine gesetzliche Frist, aber: Stelle Rechnungen zeitnah aus.
- Unter 100’000 CHF Umsatz besteht meist keine MWST-Pflicht. Falls MWST-pflichtig, unbedingt Steuersätze angeben (7,7%, 2,5%, 3,7%).
- Digitale Rechnungen (z. B. PDF per Mail) sind gültig, solange alle Angaben klar ersichtlich sind.
- Rechnungen dienen auch als Nachweis für AHV-Beiträge und Steuererklärungen – sorg also für Vollständigkeit.
4. Muster einer Freelancer-Rechnung
Freelancer Mustermann
Musterweg 12
8000 Zürich
Kunde AG
Kundenstrasse 1
4000 Basel
Rechnungsnummer: 2025-001
Rechnungsdatum: 08.09.2025
Leistungszeitraum: 01.08.2025 – 31.08.2025
Beschreibung: Beratung und Konzeptentwicklung
Nettobetrag: CHF 4´000.00
Mehrwertsteuer: entfällt ("nicht MWST-pflichtig")
Gesamtbetrag: CHF 4´000.00
Zahlungsfrist: 30 Tage netto
IBAN: CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X
5. Rechnungstools für Freelancer in der Schweiz
Vorlagen in Word oder Excel sind ein guter Start.
Noch einfacher sind Online-Tools wie Magic Heidi, MILKEE oder zistemo. Diese übernehmen die Pflichtangaben automatisch und formatieren deine Rechnung professionell.
Checkliste für deine Rechnung
- Pflichtangaben vollständig ✅
- Kunden- und eigene Angaben korrekt ✅
- MWST richtig ausgewiesen oder Hinweis „nicht MWST-pflichtig“ ✅
- Zahlungsinformationen klar angegeben ✅
- Optional: Logo, UID, detaillierte Positionen ✅
Fazit: Rechnungen sind mehr als nur ein Zahlungsbeleg – sie sind auch deine Visitenkarte.
Mit den richtigen Pflichtangaben, klarer Struktur und einem professionellen Layout stellst du sicher, dass du dein Geld pünktlich bekommst.
Und du stärkst gleichzeitig dein Image als Freelancer, der nicht nur gute Arbeit liefert, sondern auch zuverlässig und professionell auftritt.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Scheinselbstständigkeit in der Schweiz: 5 Fakten zu teuren Nachzahlungen
Scheinselbstständigkeit klingt harmlos – kann aber zum finanziellen Albtraum werden.
Denn wenn die Ausgleichskasse eine Tätigkeit nachträglich als Anstellung einstuft, wird’s richtig teuer: Sozialversicherungsbeiträge müssen rückwirkend nachbezahlt werden – in der Regel für die letzten fünf Jahre.
Und die Summen sind happig. Ein dokumentierter Fall zeigt es deutlich: Für ein Honorarvolumen von 1.080.000 CHF über fünf Jahre musste ein Unternehmen 125.000 CHF allein an AHV-Beiträgen nachzahlen.
Doch damit nicht genug – hier sind die 5 wichtigsten Fakten, die du kennen solltest:
1. Nachzahlungspflicht für beide Seiten
Es trifft Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermassen: Beide Anteile müssen nachbezahlt werden.
→ Rückwirkend bis zu fünf Jahre.
→ Wird Vorsatz nachgewiesen, kann die Frist sogar auf 10 oder 30 Jahre verlängert werden.
2. Welche Beiträge betroffen sind
Die Nachzahlungen betreffen fast alle Sozialabgaben:
- AHV/IV/EO und ALV
- BVG-Beiträge (je nach Lohnhöhe)
- Unfallversicherung, falls keine vorhanden war
- Quellensteuer bei ausländischen Mitarbeitenden
- Nebenabgaben und Verzugszinsen
3. Konkretes Rechenbeispiel
Stell dir vor, die Ausgleichskasse klopft an und präsentiert dir diese Rechnung:
- Honorarvolumen über 5 Jahre: 1.080.000 CHF
- Nachzahlung allein an AHV: 125.000 CHF
4. Risiken über die Nachzahlung hinaus
Das dicke Ende kommt oft später:
- Geldbussen sind möglich.
- Schadenersatzforderungen drohen – etwa nach einem Arbeitsunfall ohne Versicherungsschutz.
- Für Unternehmen kann das die Liquiditätsplanung sprengen, für Freelancer die finanzielle Existenz gefährden.
5. Warum es so teuer wird
Alle Lohnbestandteile der letzten fünf Jahre werden berücksichtigt.
Obendrauf kommen sämtliche Sozialversicherungsbeiträge – und Verzugszinsen.
Das Ergebnis: schnell sechsstellige Beträge.
Fazit & Empfehlung
Scheinselbstständigkeit ist kein Kavaliersdelikt. Nachzahlungen können Unternehmen wie Freelancer gleichermassen hart treffen – und sie kommen oft überraschend.
→ Für Unternehmen: Prüfe deine Vertragsmodelle rechtzeitig – bevor die Ausgleichskasse es tut.
→ Für Freelancer: Kläre deine Einstufung früh – und schütze dich vor bösen Überraschungen.
Warte nicht, bis die Kasse vor der Tür steht.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Anonyme Freelancer-Profile: 9 Gründe, warum sie fairer sind
Stell dir vor, dein Profil wird nicht nach Name, Alter oder Herkunft bewertet – sondern einzig nach deiner Leistung.
Genau das ermöglichen anonyme Freelancer-Profile. Sie verändern die Spielregeln: weniger Vorurteile, mehr Fairness und ein klarer Fokus auf Kompetenz.
Doch was bringt das konkret für dich als Freelancer – und für Unternehmen, die Talente suchen?
Was Freelancer von Anonymität haben
1. Schutz vor Diskriminierung
Dein Name oder Geschlecht spielen keine Rolle. Entscheider schauen auf deine Skills – nicht auf persönliche Merkmale.
2. Chancengleichheit
Alle starten mit denselben Voraussetzungen. Keine Bevorzugung, keine Benachteiligung – jeder Pitch zählt.
3. Fokus auf Leistung
Deine Erfahrung, deine Referenzen, deine Ergebnisse – sie stehen im Mittelpunkt. Das macht dich unabhängig von der „richtigen“ Story oder dem perfekten Netzwerk.
>> Tipps: Wie du dein anonymes Profil aufwertest
4. Hohe Vergleichbarkeit
Standardisierte Profile ermöglichen faire Vergleiche. Wer gute Arbeit leistet, fällt schneller positiv auf.
Warum Auftraggeber profitieren
5. Reduzierter Bias
Die Vorauswahl wird objektiver. Entscheidungen basieren auf Kompetenz, nicht auf Sympathie oder Beziehungen.
6. Qualitativ bessere Bewerbungen
Anonyme Profile erfordern mehr Sorgfalt. Wer sich bewirbt, meint es ernst – das steigert die Qualität der Kandidaten.
>> Weiterlesen: Die 5 wichtigsten Fragen, die du Freelancern stellen musst
7. Förderung von Vielfalt
Unternehmen bauen diversere Teams auf – ohne dass persönliche Merkmale im Vordergrund stehen. Vielfalt entsteht automatisch, wenn Kompetenz entscheidet.
Die Grenzen der Anonymität
8. Schutz nur im Bewerbungsprozess
Die Anonymität endet spätestens bei Vertragsabschluss. Dann müssen persönliche Daten ohnehin offengelegt werden.
9. Unterschiedliche Wirkung je nach Erfahrung
Senior-Freelancer profitieren stärker: Sie können anonym mit Projekten und Referenzen punkten.
Für Einsteiger ist es schwieriger, weil sie weniger Substanz zeigen können – auch anonym.
>> Tipps: So überzeugst du als Berufseinsteiger trotzdem
Fazit & Empfehlung
Anonyme Profile sind kein Allheilmittel. Aber sie schaffen ein Fundament, das fairer ist – für Freelancer und für Unternehmen.
- Für Freelancer: Nutze die Chance, deine Fähigkeiten klar in den Vordergrund zu stellen.
- Für Unternehmen: Teste anonyme Profile – und erlebe, wie Entscheidungen plötzlich objektiver und kompetenzbasiert ausfallen.
→ Am Ende gilt: Kompetenz schlägt Klischee.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Die 5 wichtigsten Fragen, die du Freelancern stellen musst
Zu spät gemerkt, dass der Freelancer keine Zeit hat? Oder dass er noch nie ein vergleichbares Projekt umgesetzt hat?
Solche Überraschungen kannst du dir sparen – wenn du im ersten Gespräch die richtigen Fragen stellst.
Diese fünf Fragen helfen dir, die Qualifikation, Arbeitsweise und Zuverlässigkeit deines Freelancers realistisch einzuschätzen.
1. Frage nach relevanter Erfahrung
„Welche einschlägigen Erfahrungen oder vergleichbare Projekte haben Sie erfolgreich abgeschlossen?“
Praxis schlägt Theorie. Ein Freelancer, der schon ähnliche Projekte umgesetzt hat, bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch Lösungswege aus der Praxis mit.
→ Beispiel: Ein Entwickler, der bereits eine E-Commerce-Plattform gebaut hat, versteht deine Anforderungen schneller und arbeitet effizienter.
2. Frage nach Arbeitsweise & Tools
„Wie gehen Sie bei neuen Projekten vor und mit welchen Tools oder Methoden arbeiten Sie, um Deadlines einzuhalten?“
Hier geht es um Struktur und Verlässlichkeit. Ein klarer Workflow zeigt, ob der Freelancer organisiert arbeitet und ob seine Tools zu deinem Projekt passen.
→ Beispiel: Nutzt er Jira oder Trello, kannst du dich auf transparente Projektplanung verlassen.
3. Frage nach Referenzen & Arbeitsproben
„Können Sie Referenzen, Arbeitsproben oder Kundenfeedback zu ähnlichen Projekten nennen?“
Nichts überzeugt mehr als echte Ergebnisse. Arbeitsproben und Kundenstimmen geben dir einen direkten Einblick in Qualität und Professionalität.
→ Beispiel: Ein Designer mit bestätigten Referenzen zeigt dir nicht nur schöne Bilder, sondern beweist auch, dass er Kundenanforderungen verstanden und umgesetzt hat.
4. Frage nach Verfügbarkeit
„Wie sieht Ihre aktuelle und geplante Verfügbarkeit für das Projekt aus?“
Selbst der beste Freelancer nützt dir nichts, wenn er keine Kapazitäten frei hat. Kläre deshalb früh, ob der zeitliche Rahmen realistisch ist.
→ Beispiel: Ein Freelancer mit 20 % Auslastung kann dich sofort unterstützen – jemand, der schon drei Projekte parallel betreut, eher nicht.
5. Frage nach Risiken & Lösungen
„Welche Risiken oder Herausforderungen sehen Sie im Projekt und wie würden Sie diese proaktiv lösen?“
Hier erkennst du, ob dein Gegenüber vorausschauend denkt. Wer potenzielle Stolpersteine schon im Vorfeld benennt, zeigt Verantwortungsbewusstsein und Problemlösungskompetenz.
→ Beispiel: Ein erfahrener Freelancer weist dich früh darauf hin, dass fehlende Briefings Zeit kosten – und schlägt direkt eine Lösung vor.
Fazit & Empfehlung
Mit diesen fünf Fragen stellst du die Weichen für ein erfolgreiches Projekt. Du erkennst früh, ob der Freelancer zu dir passt – fachlich, zeitlich und menschlich.
- Für Unternehmen: Nutze diese Fragen im nächsten Gespräch – sie sparen dir Zeit, Geld und Nerven.
- Für Freelancer: Bereite dich auf diese Fragen vor – sie sind dein Schlüssel, um Vertrauen aufzubauen und neue Aufträge zu gewinnen.
Am Ende gilt: Wer kluge Fragen stellt, bekommt die besten Antworten – und die besten Partner.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Freelancer werden in der Schweiz ohne Erfahrung: 5 Tipps für deinen erfolgreichen Start
Du willst Freelancer werden – aber dein Portfolio ist noch leer und dir fehlen die ersten Referenzen?
Keine Sorge: Auch ohne Erfahrung kannst du Auftraggeber überzeugen. Entscheidend ist, wie du dich präsentierst, welche Schritte du am Anfang gehst und wie konsequent du Vertrauen aufbaust.
Mit den richtigen Strategien gelingt dir der Einstieg – auch in der Schweiz. Hier sind fünf Tipps, die dir den Start erleichtern:
1. Baue ein Profil, das begeistert
Dein Online-Profil ist deine digitale Visitenkarte. Präsentiere dich auf Plattformen wie Freelancer-Schweiz.ch oder LinkedIn mit klaren Botschaften: Was treibt dich an? Welche Probleme löst du gerne?
→ Tipp: Betone Begeisterung, Lernbereitschaft und dein Engagement. Auftraggeber achten besonders auf Motivation und Haltung, wenn noch nicht viele Referenzen vorhanden sind.
2. Zeig Arbeitsproben – auch ohne Kundenprojekte
Kunden wollen Ergebnisse sehen – nicht zwangsläufig langjährige Erfahrung.
Nutze persönliche Projekte, Ehrenamt oder eigene Ideen, um Arbeitsproben zu erstellen.
→ Beispiel: Ein Designer kann ein fiktives Branding-Projekt entwickeln, ein Texter eigene Blogartikel veröffentlichen. So baust du ein Portfolio auf, das trotzdem überzeugt.
3. Fang klein an & baue Vertrauen auf
Der erste Schritt muss nicht das große Mandat sein. Starte bewusst mit kleineren Projekten oder niedrigeren Preisen. Auch Probetätigkeiten können ein Türöffner sein.
→ Warum? Jede positive Bewertung steigert dein Vertrauen bei künftigen Kunden – und öffnet dir die Tür zu größeren Aufträgen in der Schweiz.
4. Investiere in gefragte Fähigkeiten
Der Markt entwickelt sich rasant. Um mithalten zu können, musst du konsequent lernen.
→ Nutze Online-Kurse, Tutorials oder Zertifikate, um in deiner Nische schnell Know-how aufzubauen. Je schneller du Expertise zeigst, desto attraktiver wirst du für Auftraggeber.
5. Sei verlässlich – und übertriff Erwartungen
Gerade für Einsteiger ist Verlässlichkeit das stärkste Verkaufsargument. Pünktliche Lieferung, klare Kommunikation und Extras machen den Unterschied.
→ Tipp: Halte nicht nur deine Zusagen ein – überrasche mit einem zusätzlichen Vorschlag oder einer kleinen Verbesserung. Damit bleibst du bei Auftraggebern in Erinnerung.
Fazit & Empfehlung
Auch ohne große Projekterfahrung kannst du als Freelancer in der Schweiz überzeugen. Mit einem klaren Profil, sichtbaren Arbeitsproben, Lernbereitschaft und absoluter Zuverlässigkeit legst du den Grundstein für deinen Erfolg.
→ Für Einsteiger: Fang klein an, sammle Erfahrungen und erweitere dein Portfolio Schritt für Schritt.
→ Für Auftraggeber: Schau nicht nur auf die Jahre im Lebenslauf – frische Perspektiven von Einsteigern bringen oft echten Mehrwert.
Am Ende zählt nicht, wo du heute stehst – sondern, dass du ins Tun kommst. Dein erster Auftrag ist nur einen Schritt entfernt.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Telefonakquise 2025: Warum Schweizer Freelancer nicht darauf verzichten können
Viele Freelancer fragen sich: Ist Telefonakquise 2025 noch zeitgemäss – oder ein überholtes Relikt?
Die Antwort ist klar: Sie bleibt unverzichtbar.
Denn während digitale Kanäle überlaufen vor Newslettern, Ads und automatisierten Messages, gibt es einen Vertriebsweg, der persönlicher, direkter und wirksamer ist: Cold Calling.
Für Freelancer in der Schweiz ist es nicht nur ein Klassiker, sondern der schnellste Weg zu neuen Projekten, echten Kontakten und nachhaltigen Kundenbeziehungen. Mehr Strategien für eine volle Pipeline findest du hier: Kunden finden ohne Kaltakquise: Dein 90-Tage-Plan.
1. Digitaler Overload – das Telefon durchbricht den Lärm
E-Mail-Postfächer sind voll, LinkedIn-Feeds überfüllt, Banner blinken an jeder Ecke.
Ein persönlicher Anruf dagegen sticht heraus. Er schafft sofortige Aufmerksamkeit – und oft auch Respekt, weil sich jemand traut, direkt anzurufen.
Praxis-Tipp: Starte dein Gespräch mit einem Satz, der sofort auf das Problem deines Gegenübers eingeht – nicht mit deinem Angebot.
2. Direkt an die Entscheider
Gerade im B2B-Bereich kommst du mit einem Call schneller ans Ziel.
Du umgehst Spamfilter, überforderte Assistenzen und algorithmische Hürden – und landest direkt bei den Menschen, die über Budgets und Projekte entscheiden.
Praxis-Tipp: Frag gleich am Anfang: „Sind Sie die richtige Person für Thema XY?“ – so öffnest du Türen, ohne Druck aufzubauen.
3. Überwinde deine Call-Angst
Viele Freelancer zögern, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Wie du mit Rückschlägen souverän umgehst, erfährst du hier: Wie du in 4 Wochen als Freelancer die Testphase bestehst.
Fakt ist: Die meisten Entscheider reagieren neutral bis positiv – und ein Nein ist selten persönlich gemeint.
Praxis-Tipp: Plane dir 30 Minuten „Call-Zeit“ am Tag ein. Nach den ersten zwei Anrufen fällt die Nervosität spürbar ab.
4. So baust du in Sekunden Vertrauen auf
Ein Gespräch am Telefon erlaubt dir, individuell auf Herausforderungen einzugehen.
2025 gilt mehr denn je: Entscheider hören länger zu, wenn deine Botschaft relevant ist und echtes Interesse zeigt.
Das baut Vertrauen auf – noch bevor du ein Angebot verschickst.
Praxis-Tipp: Stelle mindestens eine Rückfrage zu einem aktuellen Thema deines Gegenübers – das zeigt echtes Interesse.
5. Warum Telefonakquise dreimal effektiver ist als E-Mail
Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache:
- Standard-Calls haben eine Response-Rate von ca. 2,3 %.
- Datengetriebene und personalisierte Calls erzielen bis zu 6,7 %.
Praxis-Tipp: Nutze vor dem Call ein kurzes LinkedIn-Research. Mit einem Bezug auf den letzten Post deines Kontakts steigen deine Chancen enorm.
6. Schnelle Anpassung, direktes Feedback
Freelancer müssen flexibel bleiben.
Am Telefon kannst du sofort testen, wie dein Angebot ankommt – und deine Botschaft in Echtzeit anpassen.
Kein anderer Kanal liefert dir so direktes Feedback.
Praxis-Tipp: Notiere dir nach jedem Call zwei Dinge: „Was hat funktioniert?“ und „Was ändere ich beim nächsten Mal?“ – so verbesserst du dich konstant.
Fazit
Ob du es Cold Calling oder Telefonakquise nennst: 2025 ist es kein Auslaufmodell, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil.
Für Freelancer in der Schweiz bleibt es der schnellste und persönlichste Weg, um neue Kunden zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und sich vom digitalen Lärm abzuheben. Und denk daran: Es geht nicht um mehr Zeit, sondern um Fokus. Hier erfährst du, wie du deinen Fokus schärfst.
→ Und jetzt zu dir:
Wie gehst du mit Telefonakquise um – unverzichtbares Tool oder nerviges Relikt? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren.
Über den Autor
Name: Amor Dhaouadi
Kurzbeschreibung:
Amor ist dein Partner und Helfer, wenn du mehr Erfolg im Beruf und im Geschäft haben willst.
Gibt Orientierung bei komplexen Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und Strategie.
Unterstützt Solopreneure und Unternehmer dabei, Klarheit zu gewinnen, Potenziale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte umzusetzen.
Der Fokus: praxisnahe Impulse, die Wachstum fördern – persönlich, unternehmerisch und strategisch.
Falls Sie Anregungen haben oder unseren Newsletter abonnieren möchten, können Sie uns hier gerne eine Nachricht hinterlassen:












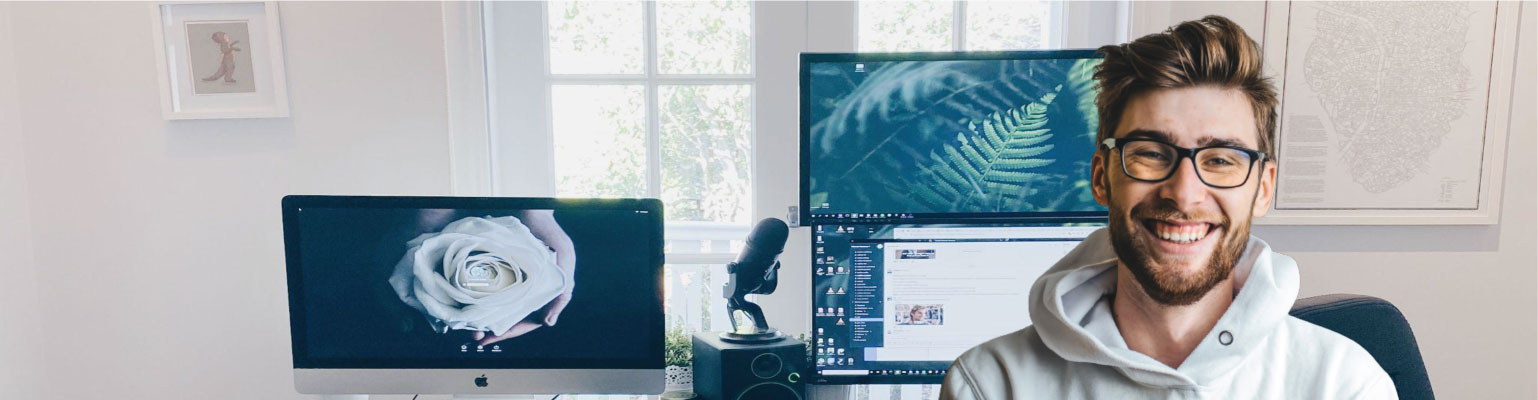



















-190ch.png)






-190ch.png)




